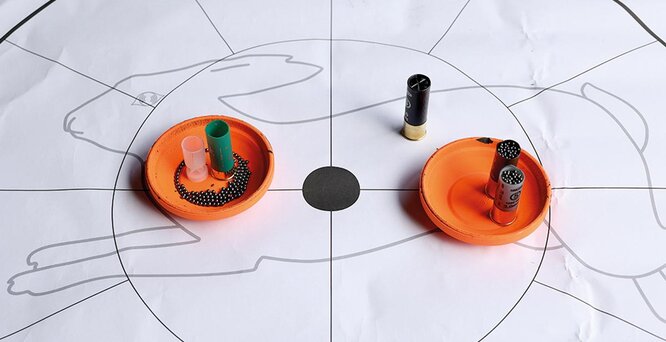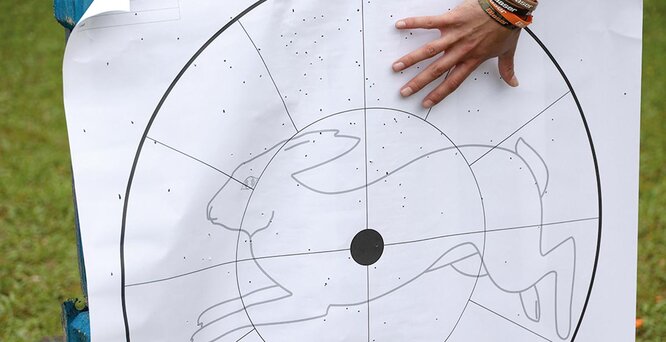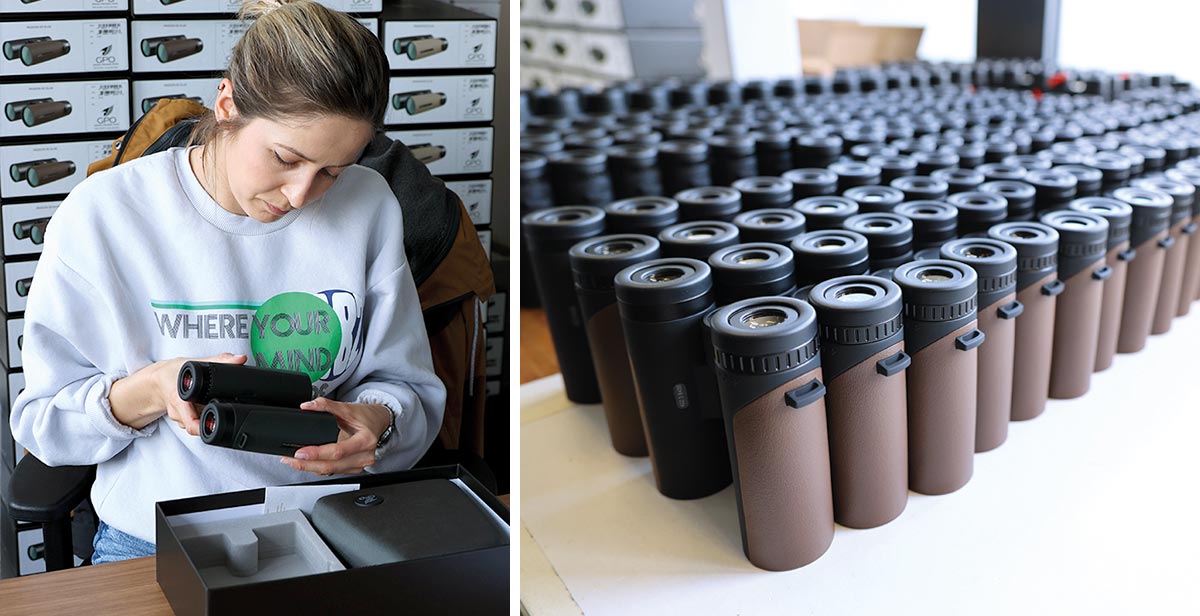Archiv 2022
Der Tierarzt im ANBLICK
Gute Schüsse steigern Wildbreterlöse enorm
Schnell tötende, saubere Kammerschüsse sind nicht nur aus jagdpraktischer sowie jagdethischer Sicht zu bevorzugen. Gute Treffer zahlen sich auch finanziell aus, da die Wildbretqualität nicht beeinträchtigt wird und die Edelteile gewinnbringend vermarktet werden können. In einer Diplomarbeit von Jürgen Jansenberger und Florian Fröis an der Försterschule Bruck/Mur wurde erlegtes Reh-, Gams- und Rotwild hinsichtlich Trefferlage, Verschmutzungsgrad und erforderlichen Zuputzes untersucht.
Blick ins Revier
Forst- und Jagdwirtschaft in einer Hand
Den Revieren der Hegegemeinschaft Wildfeld wird vielfach nachgesagt, es ginge ihnen vor allem um die Hege von Schalenwild – und hier vor allem Rotwild. Dass hier im Sinne einer zukunftsorientierten, großräumigen Zusammenarbeit erfolgreich versucht wird, unsere größte heimische Schalenwildart in unsere Kulturlandschaft zu integrieren, zeigt ein Blick in die Eigenjagd Reiting.

Die Hegegemeinschaft Wildfeld gilt nicht zu Unrecht als „Mutter“ aller Wildgemeinschaften, kann sie doch auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken. Mittlerweile befindet sie sich im achten Jahrzehnt ihres Bestehens und erstreckt sich über 15 Eigenjagden mit einer Gesamtfläche von 43.000 Hektar. Die Eigenjagd Reiting ist Teil davon. Sie macht etwa 20 % der Fläche der gesamten Wildgemeinschaft aus und schließt diese nach Süden hin ab.
Ganz im Trend der Zeit
Das wesentliche Element der Hegegemeinschaft Wildfeld ist die revierübergreifende Bewirtschaftung von Rot-, Gams-, Stein- und Rehwild. Das ist selbst in dem Fall nötig, wo allein die Eigenjagd Reiting größer ist als viele Hegegebiete mit unzähligen Kleinjagden in anderen Regionen unseres Landes, weil Wildräume sich nicht an Reviergrenzen, sondern an den natürlichen Gegebenheiten orientieren. „Gemeinsam mit den übrigen beteiligten Revieren beobachten und analysieren wir die saisonalen Bewegungen des Rotwildes in der Region sehr genau. Wir wissen von Beobachtungen markanter Hirsche bereits aus den 1950er-Jahren, dass manche von ihnen ein Streifgebiet von 30.000 Hektar haben. Wer glaubt, in einem 300-Hektar-Revier seine eigene Rotwildbewirtschaftung aufziehen zu können, liegt da völlig daneben“, zitiert Oberjäger Hanspeter Krammer ein einleuchtendes Beispiel. Die Notwendigkeit dieser auf der Ausprägung des Lebensraumes basierenden Wildhege haben mittlerweile auch viele Interessenvertreter in und außerhalb der Jagd erkannt, weshalb der Ausweisung solcher Wildräume und Wildregionen in Zukunft verstärkt Augenmerk geschenkt werden soll. Erklärtes Ziel ist es nun auch in der Steiermark, erneut eine Wildökologische Raumplanung zu entwickeln, die genau das leisten soll: dass nämlich das Wildtier mit seinen Bedürfnissen im Zentrum der Betrachtungen steht und nicht allfällige Wünsche von Naturnutzergruppen. Reviere können eine Rotwildbewirtschaftung nur auf Revierebene leisten, der Zusammenschluss von Revieren zu Wild(hege)gemeinschaften wird dem Umgang mit großräumig lebenden Wildarten auf Populationsebene gerecht, bevor diese Forderung von anderer meist wenig jagdfreundlicher Seite erhoben wird.

Wildlebensräume gestalten und erhalten – eine ureigene Aufgabe der Jagd
Indem sich der wirtschaftende und erholungsuchende Mensch immer weiter ausbreitet, drängt er das Wildtier gleichzeitig zurück. Für manche Arten ist das eher belanglos, weil sie sich damit arrangieren können. Für große rudelbildende Arten wie das Rotwild hingegen wird es eng. Es geht in manchen Bereichen schlichtweg um die Frage, ob der Mensch sich die Erhaltung von vielfältigen Wildbeständen in der Kulturlandschaft leisten kann und auch will. Und hier in der Eigenjagd Reiting will man das, wie Franz Mayr-Melnhof-Saurau als Eigentümer betont: „Rotwild ist ein Rudeltier, so ist es auch von uns zu behandeln. Wenn es saisonal zu Konzentrationen kommt, ist das ein natürliches Verhalten dieser Art. Auf der ganzen Fläche diese Konzentrationen zerschlagen zu wollen und gleichzeitig keine Rückzugsgebiete anzubieten, Wildtiermanagement nur als wahlloses Erlegen möglichst vieler Stücke zu verstehen, das kann nicht der Umgang mit unserer größten heimischen Schalenwildart sein. Von jedem, der hier mitredet, ist fachliches Grundlagenwissen, von dem man ausgehen kann und auf dem man aufbauen kann, zu erwarten. Es gilt hier, vor den immer wacher blickenden Augen der Gesellschaft gemeinsam einen zeitgemäßen und gesellschaftstauglichen Umgang mit dieser faszinierenden Wildart zu entwickeln, die alle Interessen berücksichtigt.“
Verhältnismäßig geringe Rotwildbestände
Das Wild wird in der HG Wildfeld von Berufspersonal betreut, was einen professionellen Umgang auf der Basis von immer neuen Erkenntnissen sehr erleichtert. Das Rotwild wird in zwölf Wintergattern und bei einer Freifütterung versorgt, weil auch auf dieser großen Gesamtfläche ausreichende Überwinterungsflächen für das Rotwild nicht mehr zugänglich sind. Einer der Vorteile dieser Methode ist, dass der Wildstand relativ gut erfasst und in der Folge die Entnahme geplant werden kann. Aktuell beträgt der Winterwildstand auf den 43.000 Hektar rund 2.000 Stück. Das sind weniger als fünf Stück Rotwild pro 100 Hektar und es bleibt der Interpretation jedes Einzelnen überlassen, ob das für ihn viel oder wenig ist. Tatsächlich gibt es in der Steiermark jedoch viele Reviere, wo die Entnahme pro Fläche deutlich höher liegt als hier der Lebendbestand, von dem ja nur rund ein Drittel abgeschöpft wird.
Die ausführliche Reportage finden Sie in unserer Dezember-Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.
Praxiswissen für Revierbetreuer
Das richtige Verhalten am Drückjagdstand
Drückjagden auf Schalenwild können erheblich zu einer Verringerung des Jagddrucks beitragen, wenn die Streckenerwartung optimal erfüllt wird. Damit das gelingt, muss eine Reihe von Beteiligten einen guten Job machen. Nach den langfristigen und wohlüberlegten Vorbereitungen durch den Jagdleiter und seine Helfer liegt es nun an den Schützen, den Plan in die Tat umzusetzen.

Noch liegt dicker Reif von der frostig-nebligen Nacht über dem Tal. Mein Schützenansteller hat mich gerade aus dem Fahrzeug entlassen, das mit laufendem Motor am Waldweg steht. Das beunruhigt das in der Nähe befindliche Wild weit weniger als ein Neustart. Beim Verlassen des Autos wird nur mehr im Flüsterton gesprochen. Das laute Schließen von Autotür oder Kofferraumklappe unterbleibt selbstverständlich. Nach ein paar Schritten weist er mich in den Stand ein. Mich interessiert vor allem die Sicherheit. Wo sind meine nächsten Standnachbarn, habe ich Sicherheitssektoren zu beachten oder kann ich mit natürlichem Kugelfang überall hinschießen? Wo ist das Treiben, habe ich einen Randstand, stehe ich im Zentrum des Treibens oder gar auf einem Fernwechsel? Wo sind die bekannten Einstände, wie weit sind sie entfernt und woher ist zunächst mit anwechselndem Wild zu rechnen? All diese Fragen sind wichtig für meine im Anschluss folgende mentale Vorbereitung am Stand. Ein guter Ansteller gibt diese Informationen von sich aus. Im anderen Fall sollte man unbedingt nachhaken. Wenn das Fahrzeug erst weg ist, stehen Sie mit den wichtigen Fragen ohne Antwort allein am Stand.

Für Sicherheit am Sitz sorgen!
Mit dem Sitzkissen wische ich lautlos Reif und Laub von der Stehfläche meines Standes, ebenso vom Sitzbrett und der Gewehrauflage. Gerade bei winterlichen Temperaturen oder Nässe kann man schnell auf dem Podest ins Rutschen kommen. Ideal ist, sich auf dem Weg zum Sitz zwei bis drei Fichtenzweige abzubrechen und auf der Stehfläche auszubreiten. Manchmal nehme ich dafür auch einen kleinen Beutel mit Sägemehl in meinem Rucksack mit, um es auf den Bodenbrettern zu verstreuen. Beides gibt der Stiefelsohle sicheren Halt. Wer weiß, wie turbulent es noch am Stand zugehen wird? Die Ansage des Jagdherrn lautet, dass mit Einnahme des Standes bereits vor dem eigentlichen Treiben geschossen werden darf, wenn es die Sicherheit erlaubt! Nicht selten setzt sich das Wild insbesondere bei Frost und windstillem, hellhörigem Wetter bei der geringsten Störung, die unweigerlich beim Anstellen der Jäger entsteht, in Bewegung. Aus gutem Grund wird die Waffe deshalb geladen und gesichert in die Ecke gestellt, bevor ich mich über die weitere Vorbereitung hermache.
Meine ersten Gedanken am Stand gelten der Sicherheit. Für meine eigene gegen das Ausrutschen habe ich bereits Vorkehrungen getroffen. Auch die Warnweste ist bereits angelegt und der Gewehrriemen von der Büchse entfernt. Nun gilt es, sich Orientierung am Stand zu verschaffen. Wo ergeben sich Bereiche, in denen ich sicher Wild beschießen kann? Dazu gehört in erster Linie, dass nur dort sichere Bereiche sind, wo ich mit einem angemessenen Schusswinkel das Geschoß nach Durchschuss beim Wild oder als Fehlschuss im gewachsenen Boden „begraben“ kann. Kein Baumstamm, keine Schotterstraße, keine Wasserfläche und erst recht keine Dickung sind sichere Kugelfänge – nur der gewachsene Boden! Gegebenenfalls muss ich zusätzlich noch auf steinigen Untergrund oder Felsbrocken im Gelände achten, die ungewollt zu unberechenbaren Abprallern führen können. Besonders im Gebirge oder auch in Mittelgebirgsrevieren kann Letzteres zum Tragen kommen. Eine immer wieder herausfordernde Situation zeigt sich bei Drückjagden auf Rotwild. Interessanterweise suchen sich Vertreter dieser Wildart häufig zum Wechseln im Treiben Kuppen oder Grate. Im Mittelgebirge kann es so manchen Jäger verleiten, das Wild auf einem sogenannten inneren Horizont zu beschießen, sicher in der Annahme, weit hinter dem Wild einen Hang als Kugelfang zu wähnen. Das ist ein Irrtum, denn niemand weiß auf die Entfernung, was dort im Gegenhang passiert. Ebenso riskant können flache, weite Schüsse sein, denn mit Verringerung des Winkels steigt die Gefahr, dass das Geschoß selbst bei weichem Boden diesen wieder verlässt und im Treiben für Unbehagen sorgen kann. Das kann der Jagdleiter umgehen, indem er die Drückjagdstände, insbesondere Schirme oder niedrige Böcke, entsprechend der Geländeform stellt oder sich in der Ebene gleich für Drückjagd-Türme entscheidet.

Sich selbst Grenzen setzen!
Nachdem ich am Stand „meine“ Schussbereiche festgelegt habe, gehe ich dazu über, diese in der Entfernung zu staffeln, wofür ein Entfernungsmesser gute Dienste leisten kann. Bewährt hat sich eine Drittelung. Bis etwa 30 Meter, also im Nahbereich, ist das Wild optisch gut mit jeder Fluchtvisierung – offen, Rotpunkt oder Zielfernrohr mit kleiner Vergrößerung – in Einklang zu bringen. Das Sehfeld ist optimal und der Schütze muss beim Schuss nicht aus dem Wildkörper nach vorne herausfahren. Lediglich kürzeste Schüsse auf unter zehn Metern erfordern ein starkes Mitschwingen und fast schon ein instinktives Schießen. Für den mittleren Schussbereich bis etwa 60 Meter muss der Jäger schon schießtechnisch genauer auf sein Vorhaltemaß achten, das natürlich munitionsabhängig unterschiedlich sein kann und selbstverständlich durch regelmäßige Schießstandbesuche bekannt sein und trainiert werden muss. Für sehr talentierte und viel trainierte Schützen ergibt sich unter Umständen ein weiter Schussbereich über 60 und bis 100 Meter. Schüsse in dieser Entfernung bedürfen nicht nur höchster Konzentration und Erfahrung, sie bergen ein hohes Restrisiko für den Normaljäger, das Wild tierschutzkonform zu treffen, denn nicht nur die Geschwindigkeit des Wildes, sondern auch die Geländeformation und die Stellung des Wildes zum Schützen entscheiden in Bruchteilen von Sekunden zwischen Erlegen und Anschweißen!
Den ausführlichen Beitrag finden Sie in der Dezember-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Waffe, Schuss & Optik
Gebaut für die raue Praxis
Bei Schützen sind die Lang- und Kurzwaffen von CZ weitverbreitet, der tschechische Hersteller bietet daneben auch für den Jäger einiges an Auswahl an. Und nicht zuletzt gehören die einst so beliebten Brünner Waffen nun ebenfalls zum Konzern.
Reviergang im November
Hasen sind auch nur Hirsche
Der Rammler ließ sich Zeit, viel Zeit. Vielleicht gibt es unter gewöhnlichen Waldhasen auch Philosophen, die sich Gedanken über Menschen machen ...

Einmal kommt man in ein Alter, in dem Dinge, die lange wichtig schienen, ihr Gewicht verlieren. Andere Dinge wachsen ins Bewusstsein, drängen sich vor. Da gerät man zuweilen in einen Konflikt. Mag sein, das Telefon läutet und du wirst gefragt: „Hast Zeit?“ Dabei hat der Mensch nie Zeit, außer er nimmt sie sich! Also hatte ich Zeit – also war ich …
Sie hingen mit der Abschusserfüllung dem Plan hinterher. Daher war die „Weisung“ höchst einfach: „Mach nicht lange herum; was kommt, passt …“ Für solche Einladungen muss man Zeit haben, schon weil sie rar sind.
Die Bühne, auf der ich Jäger spielen sollte, war eine beim letzten Weidegang ziemlich kurz abgegraste Wiese im Wald. Ihr Besitzer hätte sie längst „aufgefichtet“, wären die beiden jährlichen Mahdgänge nicht regelmäßig mit Wildbret gewürdigt worden. Doch jetzt im November war die Wiese kurzrasig und mit „Kuhfladen“ garniert, für einen Wiederkäuer wenig anziehend. Egal.
Grauer, stiller Novembernachmittag, irgendwo im Hang, weit weg eine Motorsäge. Das je nach Zustand der Kette bald forsche, bald gequälte „Jaulen“ und die Schläge mit dem Axtrücken auf den die Fallrichtung bestimmenden Keil. Dann, nur schwach zu hören, das Brechen von Ästen, wenn der fallende Baum durch die seiner Nachbarn brach. Ein dumpfer Schlag, wenn der Gefällte zu Boden krachte. Man saß auf der kleinen Leiter, hörte das kurze, in schneller Wiederholung vorgetragene Aufjaulen der Säge beim Ausasten. In die Stille kurzer Pause hinein das Wispern der Goldhähnchen in den die Wiese umstellenden Fichten und in schwirrendem Flug Zeisige. Eine Melodie, die zu solchem Nachmittag im Novemberwald passte.
Aber was heißt Wald? Sprachgebrauch für eine Form der Landbewirtschaftung mit Bäumen. Doch Wald ist etwas ganz anderes, etwas, dem die meisten von uns nie begegnen und auch gar nicht wollen! Etwas, vor dem die sich als zivilisiert deklarierende Menschheit eher Angst hat.
Kaum hörbares Rascheln hinterm Sitz, eher ein Schlurfen. Dann unter mir ein Dachs in üppiger Winterschwarte. Einen Moment hielt er inne, folgte meiner Spur bis zur Leiter, hielt noch einmal inne und machte sich eilig davon.
Der Sommer 2021 soll der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen sein, war im Fernsehen zu hören und dass die Grundwasserverluste in Deutschland weltweit die dramatischsten seien. Vielleicht hängen die Verluste damit zusammen, dass in diesem Land über 80 Millionen Menschen leben, dass Landwirtschaft und Industrie boomen und alle verschwenderisch Wasser verbrauchen? Doch diskutiert werden seither eher die Befürchtungen, die Bevölkerungszahlen gingen zurück …
Was tun, wenn doch ein Reh kommt, vielleicht gar Geiß und Kitz? Erlegen selbstverständlich, eh klar. Aber selbst verwerten? Die beiden Truhen sind voll. Wir essen einfach zu wenig, während unser Hausarzt ständig das Gegenteil behauptet … Was, wenn es zum fast täglich angekündigten Blackout käme? Vier Uhr schon. Wie ich aufschaute, stand am gegenüberliegenden Rand ein Rehbock und scheuerte sich mit seiner verbliebenen rechten Stange den Ziemer. Vor 1938 wäre sein Ende bei so viel Leichtsinn vielleicht besiegelt gewesen …
Genau 30 Jahre später wurde der Club of Rome gegründet, ein Zusammenschluss damals führender Persönlichkeiten und Wissenschaftler, die uns genau das voraussagten, was inzwischen Realität ist. Die Politik ignorierte alles, suchte sich und honorierte ihr ergebene Dementierer und Beruhiger … Experten! Der Bock „arbeitete“ als Schwammerlsucher. Er schien über Fähigkeiten zu verfügen, die uns fehlen: Kaum älter als drei, vier Jahre und ohne je einen Pilzführer gelesen zu haben, kannte er sich offenbar aus. Seit ich kein eigenes Revier mehr habe, werde ich immer wieder einmal zur Jagd eingeladen. Viele früher regelmäßige Einladungen bleiben aber auch aus, weil mir ein Spaziergang im heimatlichen Wald mehr zählte als eine Einladung, die den Tacho meines Autos stresst … Es macht keinen Spaß mehr, zumal beim Tanken auch ich selbst gestresst bin. Komisch ist, dass die verbliebenen Einladungen durchwegs Reh- oder Rotwild gelten.
Noch nie wurde ich dezidiert auf einen „Ernte-Rammler“ oder auf eine „3er-Nutria“ eingeladen. Früher, draußen in der alten Heimat habe ich mir an solch trüben, stimmungsvollen Novembertagen und nachdem die meisten unserer Teiche abgelassen und die Entenjagden abgeschlossen waren, immer noch einen oder zwei Stockerpel geholt. Ein stilles Jagen – ein „Stimmungs- und Küchenjagen“ wars, gemeinsam mit dem Hund …
Solche Erpel gehörten – wie die raren Ansitzhasen oder feisten Herbstschnepfen – immer zu den jagdlichen Glanzlichtern (die Deutschsprachigen sagen Highlights) des Jagdjahres. In der Ferne wieder ein fallender Baum, wieder das Aufjaulen der Säge beim Entasten. In der Wiese vor mir ein Bussard, der „zu Fuß“ die Baue der Wühlmäuse zu inspizieren schien. Einige Zeit schien er ratlos und unschlüssig, dann mochte er sich an die Empfehlungen im Elternhaus erinnern und schwang sich zur Ansitzjagd in eine der Fichtenkronen hinauf. Dann, ohne dass ich sein Kommen bemerkt hätte, saß ein Hase drei Meter neben meiner Leiter und sicherte in die Wiese hinaus – ein echter „1er-Rammler“! Sein schon weißes Gesicht sprach für eine Mitgliedschaft im Seniorenklub – fantastische Ragout-Klasse! Es mag absolut lächerlich klingen, aber sein Anblick löste eine gewisse Erregung bei mir aus, immerhin habe ich weit mehr Schalenwild erlegt als Ansitzhasen und Letztere wohl sämtliche „eigenmaulig gefressen“!
Der Rammler – vielleicht war es auch ein Rammler*in – ließ sich Zeit, viel Zeit. Vielleicht gibt es unter gewöhnlichen Waldhasen auch Philosophen, die sich Gedanken über Menschen machen, denen bevorstehende Katastrophen weniger Kopfzerbrechen bescheren als falsches Gendern?
Der Bussard gab auf, schwang sich aus des Försters „Brotbaum“ und strich ab. Als hätte er nur darauf gewartet, raffte sich auch der Hase auf und hoppelte in die Wiese hinaus. „Patsch“ und er legte sich einfach zur Seite! Da lag er: Er, den niemand in ein internationales Punktesystem aufnahm, vielleicht Länge und Breite seiner Löffel vermessen und bepunkten wollte. Niemand würde ihn im Rahmen einer Hubertusmesse würdevoll vor einen Altar tragen und feierlich verblasen. Keine Ehre des erlegten Wildes … Seine Trophäenschau würde in einer eisernen Kasserolle mit Deckel auf einem simplen Herd stattfinden …
Zur Erfüllung des Abschussplans trug ich auch nicht bei. Ob man die Gefühle, die man bei der Erlegung oder beim Verspeisen eines Hasen hat, als Wohlbefinden bezeichnen darf, weiß ich nicht. Veganer werden den gesamten Tathergang ein Verbrechen nennen. Einen Marillenen würde ich trinken und daheim noch einen Zweigelt, auf ihn und auf seine Reise in die Ewigkeit – Amen … Gefreut habe ich mich und zufrieden war ich und den Rest würde Heidi machen – viel Geliebte, ewig Treue, immer Verstehende.
Bruno Hespeler
Jagd heute
Entnahme zahlenmäßig stabil
Die Gesamtzahl der Abschüsse im abgelaufenen Jagdjahr 2021/22 hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Leicht gestiegen sind diese bei einigen Haarwildarten, beim Flugwild geht es indessen weiter bergab. Die grafischen Darstellungen zeigen die Entwicklung der Abschusszahlen seit 1990.
Blick ins Revier
Wild und Jagd im Vulkanland
Der Jagdbezirk Südoststeiermark liegt in der südöstlichsten Ecke Österreichs. Erdgeschichtlich stellt die Region mit ihren zahlreichen erloschenen Vulkanen eine Besonderheit dar. Auch jagdlich hat das Grenzland eine breite Palette zu bieten.
Waffe, Schuss & Optik
Jagdflinten gewissenhaft anschießen
Fehlschüsse mit der Flinte sind nicht immer allein mangelndem Können geschuldet. Es hat nämlich auch erheblichen Einfluss, wo die Flinte hinschießt oder wie die Deckung der Schrotgarbe aussieht. Das alles lässt sich ganz einfach überprüfen, indem man mit der Flinte auf den Schießstand geht.

Passend zum Auftakt der Herbstjagdsaison hat sich eine Gruppe von ANBLICK-Leserinnen und Lesern zu einem Seminar in der Kettner-Schießarena getroffen, um mehr über das Schussverhalten der eigenen Jagdflinte in Erfahrung zu bringen. Vortragender war der 29-jährige Martin Zendrich, ein erfolgreicher Schütze und Schießlehrer, der es auf höchst sympathische wie kompetente Weise versteht, sein Wissen an Anfänger und Fortgeschrittene weiterzugeben. Am Beginn stand die theoretische Einweisung in die Komponenten, die den gezielten Treffer schlussendlich ausmachen.
Aufbau der Schrotpatrone
Was sich nach Basics vom Jagdkurs anhört, hat ganz konkrete Auswirkungen, was den Schuss und schließlich den Treffer ausmacht. Der Aufbau der Schrotpatrone unterscheidet sich nämlich erheblich von jener bei der Büchse. Allein schon von außen gibt es markante Unterschiede, was Farbe, Form und Materialbeschaffenheit angeht. Das lässt aber noch keine direkten Rückschlüsse auf die Qualität und Verlässlichkeit der Ladung zu. So sagt beispielsweise die Höhe des Patronenbodens nichts über die Stärke der Ladung aus, auch wenn man gefühlsmäßig meinen würde, dass jene mit hohem Boden über eine stärkere Ladung verfügen.
Anders sieht es im Inneren aus. Ein zentraler Punkt ist die Schrotkornstärke, die in Millimetern oder mit einer Nummer angegeben wird. Bei gleichem Hülsenvolumen, beispielsweise im Kaliber 12/70, variiert die Anzahl der Schrotkugeln klarerweise mit dem Schrotkorndurchmesser. Während dort 130 Stück mit einem Durchmesser von 3,5 mm Platz haben, sind es bei
2,4 mm fast doppelt so viele, bei höheren Durchmessern klarerweise weniger. „Der Durchmesser der einzelnen Kügelchen schwankt um mehrere Zehntel, manche sind also dicker, andere dünner, als auf der Packung beziehungsweise Hülse angegeben. Und nicht alle sind wirklich rund, sondern auch oval oder walzenförmig. Das sind Qualitätskriterien, die vor allem von Preis und Marke abhängig sind“, erläuterte Martin Zendrich bei seinem Vortrag. Je unterschiedlicher die Schrotkugeln sind, umso unregelmäßiger entfaltet sich im Schuss auch die Schrotgarbe.
Moderate oder starke Ladung?
Wichtiges Indiz ist auch die Ladung. Es ist nämlich nicht automatisch so, dass stärker geladene Patronen auch mehr „Wumms“ haben. Vielmehr geht es darum, die vorhandene Schrotvorlage zu beschleunigen. Dass eine leichte Ladung mit 24 g Schrotvorlage mit einer geringeren Treibladung auskommt als eine mit 32 g, leuchtet ebenfalls ein. Grundsätzlich gilt das Gesagte auch für Magnumpatronen. Auch hier geht es in den meisten Fällen darum, eine höhere Masse zu beschleunigen, wofür mehr Energie vonnöten ist. Und hierbei schlägt etwas negativ zu Buche: Die Energiemenge, die nötig ist, um die Schrote aus dem Lauf zu bewegen, wirkt sich direkt proportional auch auf die Schulter des Schützen aus. „Starke Ladungen sind aus diesem Grund sehr unlustig zu schießen und damit nicht immer die erste und beste Wahl“, folgerte Zendrich.
Etwas anders sieht es bei Bleiersatzstoffen aus. Speziell bei Weicheisen alias Stahlschrot gibt es nämlich ein Problem. Aufgrund des geringeren spezifischen Gewichts von Weicheisen ist auch die Massenträgheit geringer, oder umgekehrt formuliert: Die sogenannten Stahlschrote verlieren bei derselben Ausgangsenergie und -größe schneller an Geschwindigkeit. Um hier eine gute Tötungswirkung zu erreichen, ist man auf Magnumpatronen angewiesen. Des Weiteren gilt es, den nächstgrößeren Schrotkorndurchmesser zu verwenden. Natürlich geht auch das zulasten des Schießkomforts, dazu bedarf es einer Flinte mit Stahlschrotbeschuss, um die gewünschte Leistung ins Ziel zu bringen. „Meiner Ansicht nach ist Stahlschrot in der Normalladung jagdlich unbrauchbar. Der Einsatz der Magnumpatrone macht das Defizit aber wieder wett“, fasste Zendrich seine diesbezüglichen Erfahrungen zusammen.
Einflussgrößen auf die Schrotgarbe
Bei Bleiersatzstoffen sind auch die Schrotbecher im Inneren der Hülse etwas anders ausgeformt. Bleischrote sind so weich, dass sie grundsätzlich auch ohne einen solchen verschossen werden können. Anders als der Name suggeriert, ist Weicheisen jedoch so hart, dass es beim Kontakt mit der Lauf-innenwand zu Schäden kommen kann, weshalb diese zur Gänze im Becher vom Patronenlager bis zur Mündung geführt werden. Das hat den Nachteil, dass die Schrotsäule in der Patrone etwas höher, die Schrotgarbe infolgedessen jedoch sogar kürzer ist als bei normalen Bleischroten bei gleicher Vorlage. Dasselbe Phänomen gibt es auch bei kleineren Kalibern wie der 20/76, wo die dünnere Hülse eine höhere Stapelhöhe der Schrote bedingt. Grundsätzlich sind die Schuss-ergebnisse bei gleicher Ladung, aber verschiedenem Kaliber ungefähr ident.
Die Schrotgarbe dehnt sich nach der Mündung in alle drei Achsen aus. Voraus fliegen die vordersten, schnellsten Schrote, dann kommt der Hauptteil mit dem größten Garbendurchmesser und dahinter die langsamsten Schrote. Oft sind das Randschrote, die durch die Reibung an der Laufinnenwand abgebremst worden sind. Insgesamt ist die Schrotgarbe auf eine Entfernung von rund 30 Metern bereits drei Meter lang, was bei der Trefferwirkung auf sich schnell bewegende Ziele ebenfalls zu berücksichtigen ist ...
Den ausführlichen Beitrag finden Sie in unserer November-Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen!
Praxiswissen für Revierbetreuer
Halboffene Kanzel mit Innenaufstieg und integrierter Kofferfalle
Stehen Ansitzeinrichtungen bereits seit einigen Jahren im Revier, fallen in der grünen Patina auf den Holzteilen die breiten Kratzspuren von Raubwild auf. So manches Mal findet der Jäger oben auf dem Hochsitz auch Losung von Marder und Waschbär oder trifft beim Besteigen des Sitzes sogar mit dem tierischen Untermieter zusammen. Was liegt also näher, als mit einer Klatsche zwei Fliegen zu fangen und bei der Erneuerung der Sitze gleich auch eine Falle zu installieren?
Im Revier
Der Tag beginnt früh …
Die Gänsejagd – durch Anlocken mit Lockgänsen und Lockrufen – ist eine herausfordernde als auch spannende Jagdart. Beherzigt man dabei die wichtigsten Grundregeln, können die Jäger bei gutem Licht aus dem Vollen schöpfen.

Für eine erfolgreiche Jagd darf man nichts dem Zufall überlassen. Wichtig ist zu wissen, wo die Gänse am Morgen als Erstes einfallen. Hierzu muss man ihr Verhalten in den Tagen vorher genau studieren. Wie sind die Flugrouten, wo sind die Fraßplätze? Sehen wir ein serielles Verhalten, entsteht daraus unsere Strategie und Vorgehensweise.
Die Jagd mit Lockgänsen findet auf den bekannten Äsungsflächen wie Wintergetreide, abgeernteten Maisäckern oder auch Grünland statt. Die Gänse übernachten meist auf größeren Seen oder Flüssen und werden morgens beim Einflug auf die Äsungsflächen bejagt. Alternativ jagt man beim Abendstrich wenn die Gänse wieder zum Schlafgewässer einfliegen – hier ist es aber deutlich schwieriger Beute zu machen. Grau-, Nil- und Kanadagänse kommen überwiegend als Standwild vor, ab Oktober bis etwa Februar kommen die nordischen Nonnen-, Saat- und Blessgänse dazu.
Vorbereitungen im Dunkeln
Der Aufbau des Lockbildes und Tarnschirmes benötigt viel Zeit und es sollte alles beim Einkehren der Morgendämmerung aufgebaut sein. Nachdem der Wecker um vier Uhr klingelte und uns aus dem tiefen Schlaf riss, begaben wir uns zum bereits gepackten Auto und Anhänger. Der heiße Kaffee machte das frühe Aufstehen erträglicher. Wie üblich teilten wir uns die Arbeit unter den vier Gänsejägern auf.
Gänse fliegen ungern ein Lockbild, angrenzend an Maisäcker oder Hecken, an. In unserem Revier gibt es unzählige Gräben, für welche wir uns entschieden haben den Tarnschirm aufzubauen. Die Gänseliegen blieben heute zu Hause. Während des Aufbaues des Tarnschirmes stellten wir die Vollkörper-Gänseattrappen auf. Hierbei beachteten wir die Windrichtung. Gänse fliegen ausschließlich gegen den Wind das Lockbild an. Bei der Anordnung der Lockvögel gibt es mehrere Muster, die man anwendet. Wir entschlossen uns für die einfachste Form, ein U-Muster.

Lockbilder gestalten
Lockgänse sind die wichtigsten Hilfsmittel zum Anlocken der Gänse. Das Aussehen der Attrappen entscheidet erheblich über den Erfolg oder das Ausbleiben des Anfluges der Gänse! Unser Lockbild bestand aus 30 Vollkörper-Lockvögeln und einigen Windsocks-Lockgänsen. Diese bringen Bewegung in das sonst starre Lockbild. Das Aussehen der Lockgänse muss man der bejagten Gänseart anpassen. Ein Schoof gesellt sich gerne zu seinen Artgenossen. Hierbei ist zu beachten, dass sich alle Gänsearten gerne zu den Graugänsen gesellen. Graugänse fliegen jedoch ungern das Lockbild anderer Gänsearten an ...
Den ausführlichen Beitrag von Roger Leuthard und Horst Jegen finden Sie in unserer September-Printausgabe – Kostenloses Probeheft bestellen!
Jagd heute
Wie wir das Klima wandeln
Am Rande der mitteleuropäischen Jagdtagung im tschechischen Židlochovice lud der ANBLICK die Präsidentin des Vereins Grünes Kreuz, Dr. Christa Kummer und den steirischen Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau zum Gespräch.

Frau Kummer, die Jagd ist immer eingebettet in ihr gesellschaftliches Umfeld. Wie nehmen Sie dieses Klima heute wahr?
Christa Kummer: Definitiv muss die soziale Komponente in der kommenden Zeit wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Wir haben total vergessen, dass wir Teil und nicht Herrscher über die Natur sind. Das fliegt uns jetzt um die Ohren. Fichtenmonokulturen sind eine Erfindung des Menschen. Sie sind labil und können sich auf die Auswirkungen des Klimawandels – den niemand mehr leugnen darf – nicht einstellen. Wir alle sind Zeugen einer Wende: Natur, Wirtschaft, Wissenschaft. Auch hier ist die Jagd ganz besonders betroffen. Das Prinzip „So war es eh immer“ gibt es nicht mehr. Über lange Jahre haben wir bequem gelebt und unbequeme Entscheidungen aufgeschoben. Die bequemen Schuhe müssen wir jetzt ausziehen, wir müssen neue anziehen. Veränderung ist immer verbunden mit Angst. Sehen wir den Veränderungen aber mit Freude entgegen, weil wir Pioniere sein können.
Herr Landesjägermeister, ist der klima-bedingte Waldumbau zu schaffen, ohne zeitgleich alle Anforderungen an eine tierschutzgerechte und strukturgerechte Schalenwildjagd über Bord werfen zu müssen?
Franz Mayr-Melnhof-Saurau: Das muss uns einfach gelingen! Hier sind aus meiner Sicht drei Faktoren für die Zukunft der Jagd esseziell: Erstens handelt es sich bei unseren heimischen Schalenwildarten um hochentwickelte Säugetiere, auf deren Bedürfnisse wir immer einzugehen haben. Jäger müssen darauf hinweisen, wenn es hier zu einem Ungleichgewicht kommt, wenn diese faszinierenden Wildtiere nur mehr als zu vernichtende Schädlinge betrachtet werden und es hier zu einem Ungleichgewicht kommt. Das Modell „7x64 für alle und alles“ darf nicht das Einzige sein, was wir Jäger anzubieten haben.
Zweitens haben wir eine Zunahme von Wald, er bietet aus meiner Sicht einen wesentlichen Rohstoff für die Zukunft. Auch ich lebe vom Wald und gebe im Gegensatz zu manch anderem offen zu: Den klimafitten Wald müssen wir erst entwickeln. Fragt man jene, die sich ernsthaft damit beschäftigen, blickt man überwiegend in ratlose Gesichter. Wer anderes behauptet, verlässt den Boden der Seriosität. Wir leben in Europa in einer Region der starken Industrialisierung. Allein der Stickstoff-eintrag über die Luft ist heute enorm, das beeinflusst die Wuchsleistungen in Wald und Flur. Einhergehend ist mit der Industrialisierung der dramatische Verlust der Artenvielfalt zu beobachten. Drittens ist in Österreich auch der enorme Zuwachs im Tourismus zu nennen. Im Jahr 1980 verzeichnete man in der Steiermark noch 3,5 Millionen Winter-Nächtigungen jährlich, 2018 waren es bereits rund 6 Millionen. Vor diesem Hintergrund ist zu sagen, dass Touristiker heute unsere Landschaften wesentlich mitentwickeln. Mit dem Projekt zur Etablierung eines Besucherlenkungsprogramms setzen wir in der Steiermark hier ein wichtiges und notwendiges Zeichen.
Wie weit hat sich die Gesellschaft von der Natur entfernt?
Christa Kummer: Ich habe vor wenigen Tagen mit angehenden Jägern gesprochen. Sie sind Ärzte und Eltern von achtjährigen Zwillingen, die in ihrer Schule eine sehr tierschutzbewusste Bildung erfahren. Die Eltern waren gefordert, ihren Kindern zu erklären, warum sie zukünftig auch Tiere erlegen werden. Eines der Kinder zeigte sich bald überzeugt und fand es spannend, dass Papa und Mama nun für das „Mega-bio-Fleisch“ selbst zuständig sind. Es geht also darum, wie kommuniziere ich, wie präsentiere ich, und ich glaube, wir brauchen innerhalb der Jagd nichts beschönigen und auch nichts glorifizieren, wir brauchen aber auch nichts schlechtreden. Wir sollen die Dinge einfach nur ehrlich beim Namen nennen. Trophäenjagd ist Nichtjägern praktisch nicht zu erklären. Wir Jäger wissen aber, dass alte Stücke, Wildbretgewichte und starke Trophäen auch Auskunft über die Vitalität von Wildbeständen geben etc. Dass wir uns darüber indirekt über die Trophäe freuen, muss man schon gut erklären können.
Das ausführliche Interview finden Sie in unserer Oktober-Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.
Waffe, Schuss & Optik
Mit GPO Distanzen überwinden
Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen GPO ist in der Optikbranche kein Unbekanntes mehr. Hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis steht im Stammbuch des deutschen Herstellers. Um zu zeigen, was die Produkte können, veranstaltete das Team von GPO gemeinsam mit AKAH zwei Händlertesttage am Truppenübungsplatz Seetaler Alpe.
Vererbt und angeboren
Inzucht und ihre Folgen
Als ein wesentlicher Faktor in der Wildtiergenetik wird besonders bei kleinen Populationen immer wieder auf die Inzuchtproblematik hingewiesen. Inzucht klingt dabei erst einmal unmissverständlich, eine genauere Betrachtung dieses Phänomens und seiner Konsequenzen ist jedoch notwendig.
Jagd heute
Jagd als Spielball zwischen Landnutzern und Gesellschaft
Die Entwicklungen in der Landnutzung wirken sich direkt auf die Wildlebensräume und in weiterer Folge auf die Jagd aus. Nun, in der Dauerkrise, treten viele Knackpunkte in diesem System wie unter einem Brennglas zutage. Lebensmittel, Energie – an allem scheint es zu mangeln. Gleichzeitig ist die Gesellschaft bestrebt, „die Natur“, beispielsweise durch vegane Ernährung, zu schützen und sich ein Stück weit zurückzuziehen. Wohin das alles führen mag, darüber hat sich Leopold Kirner Gedanken gemacht.

Herr Professor, die Gesellschaft steht dem Konsum von Fleisch mittlerweile sehr kritisch gegenüber. Gleichzeitig ist die Gewinnung von Fleisch ja der primäre Anreiz, warum der Mensch auf die Jagd geht. Wie stellt sich Ihrer Ansicht nach die Position des Wildbrets heute dar?
Leopold Kirner: Wildbret ist ja die Nische der Nische. Was das Fleisch angeht, essen wir zuerst Geflügel, gefolgt von Schwein und Rind. Dann kommt lange nichts, dann erst Ziege und Schaf. Dann kommt wieder lange nichts, danach erst Wildbret. Das ist also wirklich die Nische in der Nische und spielt in einer völlig eigenen Liga. Ich glaube, dass man mit Wildbret punkten kann, weil es auf natürlichen Ressourcen aufbaut. Natürlich ist es keine Biohaltung, es sind frei lebende Tiere und es ist ein begrenzter Markt. Wenn man in einer Nische ist – jetzt aus dem Ökonomischen heraus –, muss man sich nicht am Billigsten orientieren. Man kann eine bestimmte Zielgruppe erreichen, der es das wert ist, ein besonders zartes, natürliches Fleisch zu essen. Die ganze Fleischdiskussion berührt das Wildbret weniger, weil das ist ja im Promillebereich, was an Wildbret gegessen wird.
Was ist eigentlich so schlecht am Fleischkonsum?
Leopold Kirner: Weltweit nimmt der Konsum von tierischem Eiweiß zu, weil sich viele neue Gruppen das ökonomisch leisten können. Aber wir, die Länder, die viel Fleisch essen, müssen auf alle Fälle zurück. Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft steht die Lebensmittelerzeugung an erster Stelle und innerhalb dieser die pflanzliche Versorgung. Das tut uns allen gut. Und die Tiere, die wir halten, sollen naturnah gehalten werden. Das Rind sollte seine Stärke ausspielen dürfen, dass es aus Gras, aus Klee, aus Gewächsen, die wir schlecht verwerten können, Fleisch und Milch erzeugt. Nicht so, wie es jetzt passiert, das Rindfleisch wird mit Ackerfutter produziert, mit Getreide, Silage und Überseesoja. Das Rind hat dabei eine total schlechte Energieverwertung. Auch wenn man meinen würde, man könne Wildbret erweitern, indem man Wild irgendwo hält und füttert, wäre das der völlig falsche Weg. Wild kann aus Nadelspitzen Fleisch erzeugen, das ist ja das Großartige.

Um dem Dilemma zu entgehen, wird Fleisch mittlerweile ja auch im Labor hergestellt. Aber wie sieht denn die Ökobilanz von Fleisch aus der Retorte aus?
Leopold Kirner: Da sind viele Fragezeichen. Wir kennen wenig über die Umweltwirkung von Laborfleisch oder kultiviertem Fleisch. Wenn man alles mit einberechnet, glaube ich aber schon, dass es in bestimmten Bereichen Bedeutung erlangen wird. Es klingt – zumindest von der Theorie her – ja simpel. Man nimmt Stammzellen, gibt eine Nährlösung hinzu und aus dem heraus wächst das. Es wächst dabei nur das Fleisch, keine Knochen, keine Innereien, was wir ja kaum essen. Und das Tier hat einen sehr hohen Erhaltungsbedarf, damit es lebt, damit es laufen, atmen und fressen kann. Und dieser Bedarf ist beim Rind extrem hoch, weil es vier Mägen hat, das ist relativ aufwendig. Es kann aber aus Gras und Klee Milch und Fleisch machen. Spannend werden zwei Dinge sein: Wie sieht es von der Klimawirkung aus – da könnte ich aber nur Hypothesen formulieren. Und wie sieht es mit der Akzeptanz aus: Werden Menschen bei diesem Fleisch zugreifen? Wobei ich glaube: eher schon. Weil wenn man sich anschaut, wie heute Fleisch gekauft wird, dann ist das abgepackt im Geschäft. Die wenigsten machen sich beim Kaufen oder Essen Gedanken darüber, dass das einmal ein Tier war, das gelebt hat.
Dass jemand aus Glaubensgründen oder aus schlechtem Gewissen der Umwelt gegenüber kein Fleisch ist, kann man ja verstehen. Aber warum wollen Veganer oder Vegetarier überhaupt Fleischersatzstoffe haben?
Leopold Kirner: Ich glaube, dass Fleisch beliebt ist, weil es gut schmeckt. Jetzt will man das zurücknehmen, weil es in Kritik steht und negative Umweltwirkungen hat, und etwas imitieren, als ob es Fleisch wäre. Das ist gleich wie beim Haferdrink, der ja keine Milch ist, sondern ein pflanzliches Produkt. Vielleicht muss es in 20 oder 30 Jahren gar nicht mehr aussehen wie Fleisch oder Wurst. Wir sind aber schon sehr vom Fleischkonsum geprägt. Wenn man ein gutes Fest hat, isst man nicht etwas Veganes, sondern Fleischgerichte. Früher war Fleisch ja sowieso etwas Besonderes. Man hat maximal zweimal in der Woche Fleisch gegessen, weil es rar und teuer war. Und in diese Richtung geht es vielleicht wieder, weil die Ressourcenfrage schon eine wesentliche Frage ist und Fleisch sehr ressourcenintensiv ist.
Ein wichtiger Punkt bei der Nutzung tierischer Produkte ist das Tierwohl, also wie es den gehaltenen Nutztieren geht. Das Thema spielt aber auch in die Jagd hinein, egal ob es sich da um Hundeausbildung oder den Umgang der Jäger mit dem zu bejagenden Wild handelt. Was kommt hier auf uns zu?
Leopold Kirner: Spannende Frage. Ich glaube, dass die Gesellschaft derzeit eher auf die großen Player schaut, das ist die Nutztierhaltung. Und hier ist das Wildbret wieder die Nische der Nische. Davor wird noch das Feld der Haustiere thematisiert werden. Wichtig ist immer zu agieren und nicht zu reagieren, also dass man da jetzt schon gewappnet ist für zukünftige Diskussionen. Ich würde das nicht schleifen lassen und sagen, da schaut die Gesellschaft eh nicht drauf. Denn wenn das Wildbret gehypt wird als gesunde Alternative – was es ja nicht sein kann, weil es von der Menge her viel zu klein ist –, dann könnten manche Augen schärfer drauf schauen, ob das wirklich so gesund ist und so naturnah und tierfreundlich, wie behauptet wird ...
Das ausführliche Interview lesen Sie in unserer September-Printausgabe – Kostenloses Probeheft bestellen!
Im Revier
Der Weg zu reifen Keilern
Welcher Jäger träumt nicht davon, einmal im Leben einen kapitalen Keiler zu erlegen? Leider fehlt es in vielen Revieren an grimmen Bassen. Hier erfahren Sie, warum das so ist und wie man sich den Traum von einem Erntekeiler doch erfüllen kann, ohne dabei gleich eine Schweinevermehrung auszulösen.

Die gute Nachricht zuerst: Es gibt in unseren Revieren keine Schalenwildart, die leichter zu bewirtschaften ist als Schwarzwild. Denn die Stücke lassen sich problemlos ansprechen und in Frischlinge, Überläufer und Mehrjährige einteilen. Auch der Unterschied zwischen männlich und weiblich stellt –
bei halbwegs vernünftigem Licht – kein Problem dar. Warum dennoch kaum reife Keiler fallen, liegt in der Regel daran, dass die falschen Stücke erlegt werden. Zur Erinnerung: Die Frischlingsklasse sollte 70 bis 80 Prozent der Gesamtstrecke ausmachen. Doch in welchen Revieren wird das wirklich erreicht? Danach muss es den jungen Bachen gelten. Leitbachen sind in jedem Fall zu schonen, auch wenn manche Jäger anderer Meinung sind. Wer darauf achtet, hat schon viel für reife Keiler getan.
Der Umgang mitjungen Keilern
Eins der größten Probleme bei der Keilerhege ist zudem, dass zu viele männliche Überläufer geschossen werden. Nach zwölf bis 14 Monaten aus den Familienverbänden ausgestoßen, vagabundieren sie durch die Reviere. Sie erscheinen dann als Erste an der Kirrung oder stecken ihren Wurf bei bestem Licht aus dem Raps. Die wenigsten Stücke überleben diese Phase. Aber auch die zwei- und dreijährigen Keilerchen sind kleine „Tölpel“. Sie kommen – je nach Region – zwar schon auf 70 bis 100 Kilogramm Wildbretgewicht, das Gewaff ist jedoch noch unterentwickelt. Jagdliche Freuden bereiten Schwarzwildkennern Keiler erst ab einem Alter von sechs Jahren. Zu erkennen sind solche Stücke am Habitus und am Gewaff. Beim Abkochen lassen sich die Gewehre leicht aus dem Unterkiefer ziehen, weil sie von der Schleifflächenbasis bis zum Wurzelkanal dieselbe Breite aufweisen. Reif ist so ein Keiler jedoch immer noch nicht, denn erst im Alter von acht Jahren hat er den Namen Hauptschwein verdient.
Strenges Bejagungskonzept
Der erste Schritt sollte sein, vorrangig Frischlinge und ab Oktober Überläuferbachen bejagen zu lassen. In dem Revier, wo ich jage, geschieht das fast ausschließlich im Feldteil des Reviers. Innerhalb des Waldes wird Schwarzwild ausschließlich auf Bewegungsjagden erlegt. Männliche Stücke, die älter als ein Jahr sind, dürfen weder im Feld noch im Wald erlegt werden! Bei den Bewegungsjagden werden zudem nur Stücke bis 50 Kilogramm freigegeben. Bei gemischten Rotten sind zunächst nur Frischlinge frei. Erst wenn alle liegen, wird in die Klasse der weiblichen Überläufer eingegriffen. Natürlich kommt es hin und wieder zu Fehlern beim Ansprechen. Doch aufgrund der hohen Anzahl erlegter Frischlinge sind diese „Fehlabschüsse“ unbedeutend. Nach nur vier Jahren konsequenter Schwarzwildhege konnten die ersten Keiler freigegeben werden. Statt eines Gewichtslimits von beispielsweise 100 Kilogramm sollten die Jäger aufs Gewaff schauen. Wenn „eine Zigarettenlänge“ Keilerzahn aus dem Gebrech ragte, war das Stück frei. Wichtig dabei: brauchbares Licht. Beim Nachtansitz muss daher lieber einmal mehr als zu wenig hingeschaut werden.
Den Jägern wurde das Ansprechen dadurch deutlich erleichtert. Einen alten Keiler zu erkennen ist wirklich einfach: Beginnt man nachzudenken, ob der Keiler das passende Alter hat, ist er nämlich stets zu jung! Auf extrem kurz wirkenden Läufen stehend, am Widerrist deutlich überbaut, mit abfallender Rückenlinie und einem Pürzel, der fast den Boden erreicht, verrät ein Hauptschwein, dass es diesen Namen auch verdient.
Um das Hegeziel zu erreichen, sollte man reife Keiler nicht für besondere Gäste zum Abschuss freigeben. Nur wer am „Altwerden“ beteiligt war, sollte so einen Keiler auch erlegen dürfen! Nur so halten sich alle Beteiligten an die Jagdbeschränkungen, die für das Jahr über für Keiler gelten. Chancengleichheit muss sein, denn sonst bricht das ganze System zusammen.

Man sieht sie wieder: starke Bassen
Dieser einfach umzusetzende Umgang mit den Sauen produzierte in relativ kurzer Zeit sowohl männliche als auch weibliche Stücke in der Reifeklasse, was so niemand für möglich gehalten hatte. Die Sozialstrukturen waren intakt, da ausreichend Leitbachen vorhanden waren.
Ein angenehmer Nebeneffekt dieser Bejagungsrichtlinien ist, dass die Schäden in der Feldflur drastisch sinken! Die intelligenten Sauen hatten und haben nämlich gelernt, dass sie im Wald sicherer sind. Zudem konnte meine Försterin beobachten, dass die Sauen viel standorttreuer wurden, besonders die Keiler. Im Wald ließen sich die dicken Burschen in anderen Revierteilen sogar regelmäßig am Tag beim Brechen beobachten. Es bedarf keiner „Riesenreviere“, um Keiler alt werden zu lassen. Man muss sie nur in Ruhe lassen. Das Streifgebiet eines alten Keilers ist übrigens lange nicht so groß, wie immer wieder behauptet wird. Im Gegenteil: Es ist mit dem eines Rehbocks vergleichbar. Lässt der Jäger den Bassen in Frieden, genügen ihm wenige Hektar als Einstand. Wie ein bekannter Rehbock, der abends um fünf nach acht auf dem Wildacker erscheint, halten sich erfahrungsgemäß auch die Keiler an ihre Zeiten. Dieses urige Wild ist schon ein faszinierender Anblick. Wir müssen nur auf den Wind achten. Werden sie jedoch durch eine Unvorsichtigkeit gestört, bleiben sie mehrere Wochen aus. Zur Rauschzeit gibt es leichte Wanderbewegungen. Der Bezug zum selbstgewählten Territorium bleibt jedoch stets erhalten.
Man sieht, alte Keiler heranzuhegen ist nicht so schwer. Man braucht eine innere Disziplin, etwas wildbiologisches Wissen und Geduld. Dann kann’s klappen.
Andreas Haußer
Waffe, Schuss & Optik
Steel Action – ein Geradezug-Repetierer für die Praxis
Geradezug-Repetierer haben in der österreichischen Jagd Tradition. Manche Jäger erinnern sich an die Mannlicher Modell-1895-Geradezugbüchsen (M95) unserer Großväter. Die technische Entwicklung schritt fort, und nun ist mit der deutschen Steel Action wieder eine robuste Geradezug-Repetierbüchse auf dem Markt.
Blick ins Revier
Schnepfenhabitat mitten im Kärntner Wolfsgebiet
Das mittlere Drautal macht aktuell wegen der Wolfsrisse als auch der Freigabe von Problemwölfen Schlagzeilen. Aus jagdlicher Sicht hat es aber noch viel mehr zu bieten, etwa ein Schutzgebiet für Waldschnepfen, das die Kärntner Jägerschaft mitunterstützt.

Zwischen Oberem und Unterem Drautal befindet sich das Lurnfeld – ein ausgedehnter Talboden zwischen den ansonsten eher steilen Talschaften Oberkärntens. Jagdlich verwaltet wird die Region von Bezirksjägermeister Franz Kohlmayer. Der hier wohnhafte Hirschberger stand auch dem örtlichen Jagdverein lange Zeit als Obmann vor. In seiner aktiven Zeit war er beim örtlichen Lagerhaus tätig, kennt also auch von dieser Seite her Land und Leute ausgezeichnet. Sein Jagdbezirk Spittal an der Drau ist größer als das Bundesland Vorarlberg und an Vielfalt kaum zu überbieten, grenzt er doch an Murau, den Lungau, Pongau, Pinzgau und auch an Osttirol an. Er hat uns ein Stück weit in seine Welt mitgenommen und aufgezeigt, was die Kärntner Jagd momentan bewegt.
Mitten im Wolfsgebiet
Eigentlich berühren Wölfe die Jagd ja nur am Rande, doch rund um das Lurnfeld stellt sich die Situation gerade anders dar. Nachdem es heuer schon so viele Schafsrisse gab, trat der Kärntner Notfallplan in Kraft. Seit Wochen ist ein Problemwolf zum Abschuss frei – doch bislang ohne Erfolg. „Das ist ja nicht so einfach, einen Problemwolf zu erlegen“, weiß der Bezirksjägermeister aus eigener Erfahrung zu berichten. „Nach Rissen hab ich mich bei Vollmond selbst drei Nächte lang auf einer Alm angesetzt – ohne jeden Erfolg. Wenn, dann wäre das ja eher eine Zufallsbegegnung beim Ansitz, aber einen Wolf ganz gezielt zu bejagen ist nicht so leicht.“ Aus diesem Grund gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Bescheiden, die immer weiter ausgeweitet wurden. Anfang Juli war der Problemwolf im Umkreis von rund 10 km rund um das Lurnfeld frei.
Mit von der Partie ist auch Hegeringleiter Ofö. Ing. Hans Obertaxer, der dem Wolf zumindest schon einmal persönlich gegenübergestanden ist. „Wie jeden Morgen ging ich mit meinem Wachtelrüden entlang der Drau durch die Au. Plötzlich zeigte der Hund ein ganz ungewöhnliches Verhalten und begann ohne sichtlichen Grund zu bellen. Dann sah ich ihn – ein stattliches Tier, das wohl kaum mit einem Schäferhund verwechselt werden kann.“
Bei unserer Revierbegehung kommen wir an den Koppeln von Peter Vinatzer vorbei. Auf der Schattseite oberhalb vom Lurnfeld, am sogenannten Lampersberg, bewirtschaftet er eine Zuhube zum Hauptbetrieb in Baldramsdorf in Tal. Dort weiden Kärntner Brillenschafe, rund 60 an der Zahl, gut verwahrt hinter dem elektrischen Weidezaun: „Bei mir war er noch nicht, der Wolf“, meint er. „Ich hab aber schon zu meiner Frau gesagt: Wenn er bei uns Schafe reißt, dann hören wir damit auf. All das Tierleid, der Ärger – das tun wir uns dann nicht mehr weiter an!“
Wenig später treffen wir auf der Sonnseite den Kolmwirt am Hühnerberg bei Lendorf. Von seiner Terrasse aus kann man das Lurnfeld gut überblicken, bis es bei Sachsenburg ins Obere Drautal beziehungsweise ins Mölltal übergeht. Nach Osten hin breitet sich der Millstätter See aus, gleich daneben liegt die Bezirkshauptstadt Spittal an der Drau. Und einen guten Steinwurf unterhalb seines Gasthauses steht eine „Schupf’n“, also ein kleines Wirtschaftsgebäude. „Dort hat der Wolf erst vor zwei Wochen Schafe gerissen“, berichtet er. „Auf der frischen Erde haben wir sogar seine Pfotenabdrücke gefunden.“ Der Kolmwirt ist übrigens ebenfalls eine zentrale Person im örtlichen Jagdverein. Im Untergeschoß befindet sich der Zerwirkraum, in dem das erlegte Wild gekühlt und zerwirkt wird. Einen Teil des Wildbrets braucht er in der Küche, der Rest wird von den Jägern selbst verzehrt.
Käme es tatsächlich zur Erlegung eines Wolfes, wäre die Vorgehensweise danach übrigens klar geregelt. Der Tierkörper müsste der Behörde zur Untersuchung beziehungsweise weiteren Verwendung übergeben werden. „Ich persönlich hätte kein Problem damit, einen Wolf zu erlegen und abzugeben“, so Franz Kohlmayer. „Es ist ja alles gesetzlich geregelt. Bei uns muss es ja auch nicht der eine Problemwolf sein, also ein spezielles Individuum, weil bei uns in Oberkärnten sind aktuell sicherlich acht bis zehn Wölfe unterwegs.“

Daniela Pichler, Hegeringleiterin von Sachsenburg: „Das Kärntner Jagdgesetz bietet in Bezug auf die Abschussplanung so viel Spielraum, dass Schonzeitaufhebungen eigentlich nicht notwendig sein sollten.“
Schonzeitaufhebungen beim Schalenwild
Ein anderes Dauerthema betrifft die Bemühungen um die Schalenwildreduktion. Nach Schneedruck, Windwurf oder Waldbrand und in der Folge Borkenkäferbefall müssen viele Flächen wiederbewaldet werden. Die Forstseite drängt daher darauf, die Schalenwildbestände so weit zu reduzieren, dass sich eine standortgerechte Verjüngung entwickeln kann. Teilweise ist auch viel Geld der öffentlichen Hand in die Wiederbewaldung geflossen und nun, nach einer Evaluierung, steht fest, dass die gesetzten Ziele oft nicht erreicht wurden.
Hegeringleiter Hans Obertaxer war in seiner aktiven Zeit selbst als Förster tätig und sieht das differenziert. „Es gibt viele Hemmnisse, die eine Verjüngung erschweren, das Schalenwild ist nur eines davon. Wenn ich bei mir die Paula-Flächen anschaue, also die Sturmflächen, die vor rund 15 Jahren entstanden sind, dann stimmt mich das aber positiv. Das hat damals auch sehr dramatisch ausgesehen, mittlerweile sind die ehemaligen Schadflächen gut bestockt. Rund 50 % sind Laubhölzer, was unter anderem auch das Haselwild sehr freut.“
Einig sind sich er und BJM Kohlmayer auch in der Frage der Wilddichte: Diese ist bereits stark abgesenkt worden. Schonzeitaufhebungen halten sie aus diesem Grund für nicht notwendig, wenn nicht sogar für kontraproduktiv, wie sie sich überhaupt dagegen verwehren, die Jagd allein als hochtechnisierte Schädlingsbekämpfung zu betrachten.
Dass die Abschusserfüllung auch mit traditionellen Methoden zur Zufriedenheit aller erfolgt, meint auch Daniela Pichler, Hegeringleiterin von Sachsenburg und die erste Kärntner Frau in solch einem Amt. „Das Kärntner Jagdgesetz gibt uns viele Werkzeuge in die Hand, um unseren Aufgaben nachgehen zu können. Dank des zweijährigen Abschussplanes und auch der Möglichkeit, für den ganzen Hegering oder Teile davon einen gemeinsamen Abschussplan erstellen zu können, sind wir sehr flexibel. Gerade bei den Zuwachsträgern geht es ja darum, dass diese dort erlegt werden können, wo sie sich aufhalten – und das kann auch jenseits der eigenen Reviergrenzen sein.“ Beim gemeinsamen Abschussplan gilt übrigens die Regel, dass jedes Stück in grünem Zustand dem Hegeringleiter oder einer anderen Vertrauensperson vorzulegen ist. Doch selbst das sieht man hier ganz entspannt.
Den vollständigen Beitrag finden Sie in der August-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Waffe, Schuss & Optik
Umfangreiches Jungjägerpaket zum attraktiven Vorzugspreis
Trotz genereller Preissteigerung in praktisch allen Lebensbereichen wird derzeit ein Jungjägerpaket deutlich unter dem Ladenrichtpreis angeboten. Der Sabatti-Repetierer samt Zielfernrohr, Fernglas mit Entfernungsmesser und Spektiv von DDoptics kostet dabei weniger als anderswo die Waffe selbst. Doch was kann das Paket?
Im Revier
Tollwut in Teilen Europas noch häufig
Wenn auch die Tollwut derzeit überwiegend in Asien und Afrika vorkommt, ereignen sich zahlreiche Fälle in Ost- und Südosteuropa. Besonders im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, mit dem Verbringen von Hunden und Katzen in Richtung Mitteleuropa sowie mit Jagdreisen sollte die Tollwut nicht unbeachtet bleiben.

Das Krankheitsbild der Tollwut mit der für den Menschen typischen Wasserscheu aufgrund des Unvermögens Erkrankter, Wasser zu schlucken, und Tobsuchtsanfällen ist seit zumindest 2.500 Jahren bekannt. Noch früher finden sich im babylonischen Codex Eshnunna etwa 1930 vor Christus Strafbestimmungen gegen Besitzer Tollwut übertragender Hunde. Lange Zeit hielt man jedoch Tollwut bei Tieren und beim Menschen für zwei Krankheiten. Aristoteles hat eine Übertragung auf den Menschen noch ausgeschlossen. Rund 300 Jahre später wurde von griechischen und römischen Ärzten ein epidemiologischer Zusammenhang zwischen der Wut bei Tieren und beim Menschen sowie die Übertragbarkeit durch Bisse erkannt. Ebenso bekannt waren unterschiedlich lange Inkubationszeiten zwischen dem Biss und dem Ausbruch der Krankheit. Galenus beschrieb eindrucksvoll die Klinik der Tollwut beim Hund: „Hunde sind toll, wenn sie mit geröteten Augen, eingezogenem Schwanz, speicheltriefender Schnauze, heraushängender, gelblich gefärbter, trockener Zunge, heiserem Geheul und schwankendem Gang umherstreunen und dabei blindlings jedermann anfallen und beißen.“
Seit Plinius dem Älteren ist eine aus dem Aberglauben abgeleitete Vorbeugungsmaßnahme bekannt: Jahrhundertelang entfernten „Wurmschneider“ einen wurm-ähnlichen Fortsatz an der Unterseite der Zunge von Hunden, den „Tollwurm“, um den Ausbruch der Tollwut zu verhindern. Im Mittelalter galt St. Hubertus auch als Schutzpatron gegen Tollwut und in Klöstern wurden Wunden gebissener Menschen nach alter Methode ausgebrannt und zusätzlich ein Faden aus der Stola des Geistlichen eingelegt sowie die Wunde für neun Tage verbunden. Diese Patienten mussten zur Beichte und Kommunion gehen, täglich neun Vaterunser beten und es streng vermeiden, in einen Spiegel zu blicken. Die Tollwut wurde damals auch als „Le mal de St. Hubertus“ (Hubertus-Krankheit) bezeichnet, vermutlich auch deshalb, weil die Tollwut häufig Jäger betroffen hat. So hat im Jahr 1830 allein ein englischer Chirurg rund 400 Bissverletzungen, überwiegend bei Jägern, behandelt. Tobsuchtsanfälle, bei denen Menschen heulten wie Wölfe oder Werwölfe, galten meist als gottverhängte Strafe.
Im Zuge von oft lang andauernden mittelalterlichen Kriegen – verbunden mit den Jagdprivilegien des Adels – vermehrten sich Füchse und Wölfe und waren hauptverantwortlich für massive Seuchenzüge. Dazu kommen in Kriegswirren noch zahlreiche streunende Hunde. Im Zuge des Hundertjährigen Krieges wurde berichtet, dass fast täglich mehrere wutkranke Wölfe in den Straßen von Paris erschlagen wurden! Etwas später befahl Heinrich IV., alle herrenlosen Hunde totzuschlagen, und dies vor allem in den „Hundstagen“.
Den vollständigen Beitrag finden Sie in unserer August-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Praxiswissen für Revierbetreuer
Schalenwild effizient aus der Decke schlagen
Beim Aus-der-Decke-Schlagen gibt es regional verschiedene Methoden. Wer keinen Wert auf die Verwendung der Decke als Dekoration oder Leder legt, sollte es einmal bei seinem nächsten erlegten Stück Schalenwild mit der Ruckzuck-Methode probieren. Sie spart nicht nur Zeit, sondern schont die Kräfte und hinterlässt sehr sauberes Wildbret.
Jagderlebnis
Blattjagd in den steirischen Bergen
Unter dem Sitz angelangt, glaste ich den gegenüberliegenden Grabenrand ab. Doch nichts war zu sehen, also erklommen wir den kurzen Steig der Böschung und richteten uns im Sitz ein. Nachdem wir etwas mehr als eine Viertelstunde zugewartet hatten, griff ich zum Blatter und schickte die ersten Fieptöne hinaus in die herrliche Bergwelt ...

Das Jagdjahr in unserem neuen Revier schritt voran und die hohe Zeit des Rehwildes war gekommen – Tom und ich fieberten der Blattjagd auf den roten Bock entgegen! Neben zwei Wildwiesen im Talbereich weist das Revier zahlreiche Schläge und Gräben auf, die dem Rehwild hervorragende Äsungsverhältnisse und Einstände bieten, andererseits aber schwer zugänglich sind. Als wir im Frühjahr die ersten Pirsch- und Besichtigungsgänge unternahmen, wurden wir aus diesen Einständen sofort vom Rehwild „aufs Ärgste beschimpft“, laut hallten die Schrecklaute aus den dicht verwachsenen Hanglagen, wenn uns die Rehe in den Wind bekamen. Damit war uns schon früh klar – Rehwild gibt es genug, aber beizukommen würde ihm schwer sein. Trotzdem war die bisherige Bejagung sehr gut verlaufen, vor allem in der Jugendklasse war der Abschuss schnell erfüllt. Den Höhepunkt sollte aber die hohe Zeit der Rehbrunft auf einen reifen Trophäenträger erbringen.
Vor dem ersten August soll man keinesfalls blatten! So lauten zumindest die Empfehlungen vieler, oft selbsternannter, Blattjagdspezialisten. Im Gebirge wird sogar aufgrund der Höhenlage ein noch längeres Zuwarten empfohlen, bevor man zum Blattinstrument greifen sollte. Wenngleich in jeder Empfehlung auch ein Körnchen Wahrheit liegen mag, so verlasse ich mich trotzdem viel lieber auf mein eigenes Gefühl, beobachte die Wettersituation und ziehe die Erfahrungswerte meiner nun doch schon beinahe über vier Jahrzehnte andauernden Jagdpraxis heran. Gerade Ende Juli, wenn der Testosteronspiegel der Böcke bereits entsprechend hochgefahren ist, die meisten Geißen aber nur wenig Brunftbereitschaft zeigen, kann das Blatten schon erste Erfolge bringen. Die Böcke „suchen“ bereits nach paarungsbereiten Geißen und so ist es keineswegs in Stein gemeißelt, dass vor dem ersten August bestenfalls nur junge Rehböcke auf die Fieplaute reagieren. So zumindest meine Erfahrungswerte über die Jahre! Meine Frau Cornelia hat keinen Jagdschein, doch interessiert es sie sehr, mich manchmal auf meine Pirschgänge zu begleiten. Es war die letzte Juliwoche im ersten Jahr der Pachtperiode und wir verbrachten herrliche Sonnentage auf der Jagdhütte. Wir schrieben den 30. Juli und brachen erwartungsvoll am späten Nachmittag eines angenehm warmen Sommertages zum Abendansitz auf. Unser Ziel war der „Panoramasitz“, ein zwischen zwei Lärchenstämme hineingebauter Bodensitz. Aufgrund seiner Hanglage erlaubt er einerseits eine gute Sicht auf die darunter vorbeiführende Forststraße und in den darunterliegenden breiten Graben, andererseits auch einen weiten Ausblick über das Panorama der Bergwelt der Umgebung – daher rührt auch die Namensgebung. Schon der Weg dorthin ist wunderschön, man saugt die tausend Gerüche des Waldes in sich auf und jederzeit kann am Rand der Forststraße ein Stück Wild in Anblick kommen. Und einen solchen hat man sehr oft, auch wenn es „nur“ ein Waldhase sein mag, der aufgeschreckt der sicheren Deckung zustrebt. Auch das Haselwild, das in unserem Revier erfreulicherweise sehr häufig vorkommt, fühlt sich hier wohl.
Das vollständige Jagderlebnis von Hermann Reichl finden Sie in unserer Juli-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Im Revier
Ab durch die Hecke!
Eine kleine Gruppe von Jägern lässt sich vom Kleinerwerden des Jagdgebietes in Mühldorf bei Feldbach nicht unterkriegen und arbeitet unermüdlich für die Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Niederwildbesätze sowie deren Lebensräume. Worauf es bei der Niederwildhege ankommt, veranschaulichten uns Roman Marbler und Gernot Zehenthofer bei einem gemeinsamen Reviergang.

Zu Beginn der Reviererkundung führten uns Roman Marbler, Obmann des Jagdvereins Mühldorf, und sein Jagdkollege Gernot Zehenthofer auf den Steinberg. „Hier auf dem Steinberg brütet sogar der Uhu“, erzählte uns Gernot. Vom Steinberg aus überblickt man Richtung Süden das ganze Jagdrevier. Rund 750 Hektar beträgt die Gesamtfläche der Gemeinde – doch nur rund 350 Hektar können jagdlich genutzt werden. Was einem auch gleich auffällt, ist die B 66. Die Bundesstraße durchtrennt das Jagdrevier und zählt zu den gefährlichen Schlüsselstellen für das Wild. Trotz Anbringens von akustischen und optischen Wildwarnern fallen pro Jahr noch immer 10 bis 15 Stück dem Verkehr zum Opfer. Zum Fallwild zählen hauptsächlich Rehe, aber auch Schwarzwild versucht gelegentlich die Straße zu queren. Das Schwarzwild zählt in Mühldorf nicht zum Standwild. Die Schwarzkittel wechseln sporadisch durch das Mühldorfer Revier. Auch das Rotwild zieht zeitweise vom Burgenland kommend nach Mühldorf. Zwei bestehende landwirtschaftlich genutzte Rotwildgatter locken die wild lebenden Hirsche besonders in der Brunft an. Es kommt immer wieder vor, dass die Mühldorfer Jäger ein Stück Rotwild erlegen. Es gibt auch mehrere Teiche im Revier, wo sich Stockenten und Biber angesiedelt haben. Die Katastralgemeinde Mühldorf gehört zur Stadtgemeinde Feldbach und liegt etwa zwei Kilometer von Feldbach entfernt. Über die Bundesstraße 66 Richtung Bad Gleichenberg gelangt man nach Mühldorf am Fuße des Steinberges. Am Steinberg wird seit dem 17. Jahrhundert gewerblich Basalt abgebaut. Das Material wird hauptsächlich für den Straßen- und Bahnbau verwendet. Die markante orange-rötliche Farbe macht das Vulkanlandgestein unverkennbar. Der kleine Ort des Bezirkes Südoststeiermark ist geprägt von zahlreichen Hügeln, klein strukturierten Wiesen und Äckern sowie Waldflächen, Wein- und Obstgärten. Aber auch in Mühldorf macht der Wohnbau keinen Halt – die schönen Lagen in Stadtnähe sind eben sehr begehrt.

Das Hauptaugenmerk des Jagdvereins Mühldorf liegt in der Erhaltung und Verbesserung der Habitate für das Niederwild. „Der Jagdverein besteht aus 12 Mitgliedern und wir ziehen Gott sei Dank alle an einem Strang“, erzählt Roman Marbler ganz stolz. „Jede mögliche und von den Landwirten ungenutzte Fläche wird von uns in Form von Hecken oder Wildäckern genutzt. In Summe betreuen wir momentan sechs Ökostreifen zu je einem halben Hektar. Das Übereinkommen mit den örtlichen Landwirten und Grundbesitzern ist besonders gut und dieses Einverständnis stellt auch die Grundvoraussetzung für unsere Arbeit dar.“ Die Hecken werden von den Jägern mit den verschiedensten Sträuchern bestückt. Dazu zählen Wildrosen, Schlehdorn, Heckenkirsche, Gemeiner Schneeball, Sanddorn, Hartriegel, Pfaffenkapperl und Brombeeren. Beim Näherkommen hört man schon das laute Summen der Bienen, die vor den Blüten der Büschelrose (Multiflora) eifrig herumschwirren. „Nach dem Setzen der Pflanzen zäunen wir die Fläche ein. Die Rehe verbeißen sonst die jungen Triebe und Blätter zu stark, so dass die Hecke nicht dicht anwächst. Wir stellen einen Maschendrahtzaun mit Holzpfählen an den Ecken und dazwischen mit Eisenstangen auf. Das Um und Auf ist das Freimähen des Zaunes, den wir nach spätestens drei Jahren wieder entfernen“, beschreibt Marbler. In den Folgejahren müssen die Hecken zurückgeschnitten werden, damit sie einerseits nicht in die Breite wachsen und die Kulturen der Landwirte überwuchern und andererseits um das Wachstum der Pflanzen anzuregen. In den ersten Jahren erfolgt das Zurückstutzen per Hand. Später kommen die Maschinen zum Einsatz, die die Landwirte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle zwei Jahre wird ein Teil der Hecke auf Stock gesetzt und die Sträucher wachsen von Grund auf wieder neu aus. Nicht nur für Fasan und Hase eine gute Deckungsmöglichkeit – auch für Brutstätten unserer Singvögel bieten sich die Hecken optimal an.

Neben den Hecken bewirtschaften die Jäger Wildäcker auf insgesamt 2,2 Hektar und Wildwiesen auf 1,5 Hektar. Die einzelnen Flächen werden immer streifenweise nebeneinander mit Mais und Hirse bestellt bzw. mit der Meran’schen Wildäsung nach Fladenhofer eingesät. Der Mais bleibt über den Winter stehen, die Kolben dienen in der kalten Jahreszeit als Äsung. „Alle zwei Jahre werden die Wildäcker und -wiesen geschlegelt und wieder in abwechselnder Reihenfolge bestellt. Dadurch soll der Druck des Maiszünslers verhindert werden. Klar, wir zielen hier nicht auf den Ertrag ab, aber so wirken wir dem Schädling ohne chemischen Pflanzenschutz entgegen“, so Marbler.
Die ausführliche Reportage finden Sie in unserer Juli-Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.
Im Revier
125 Jahre Alpenländische Dachsbracke
Österreich ist das Mutterland der Alpenländischen Dachsbracke, die auf eine sehr lange Tradition zurückblicken kann. Die Besonderheiten der Dachsbracke sind ihr eiserner Spurwille und ihr unverwechselbarer Spurlaut. Um eine ihren Anlagen entsprechende Haltung sicherzustellen, wird sie ausschließlich an Jäger abgegeben.
Waffe, Schuss & Optik
Munition: Knapp und teuer wie nie zuvor!
Was den meisten Jägern bei der Vorbereitung auf die heurige Jagdsaison bereits unangenehm aufgefallen ist, nimmt in seiner Dramatik weiter zu: Der Preis für Jagdmunition ist massiv gestiegen, viele Laborierungen sind gar nicht verfügbar. Zwei Kenner der Branche erläutern, was hier dahintersteckt.
Reviergang im Juni
Was uns die Dinge wert sind ...
Ich war zufrieden, hatte die taufrische Nachtluft geatmet, und da war ja noch jener Wachtelhahn, dessen Ruf heute fast so selten zu hören ist wie das Kullern der Spielhahnen. Nicht zu vergessen die Begegnung mit der Bache und ihren gestreiften Kindern ...

Was bist dann du für ein Jager?“, fragte mich mein Gegenüber, als ich bekundete, dass mir ein sauber erlegtes Schmalreh für die eigene Küche genauso lieb sei wie ein Rehbock. Als ich dann auch noch gestand, einen dreijährigen unmarkierten Rehbock nicht halbwegs sicher von einem fünfjährigen unterscheiden zu können, war es ganz aus.
Fast Mitternacht, als ich ins Hotel kam. Halb vier, als mich die Elektronik weckte. Da saß ich dann in der Früh auf jenem Sitz am Waldrand, eingekuschelt in den geliehenen sonst Herbst- und Wintertagen vorbehaltenen Parka, war bemüht, nicht einzuschlafen. Ein Mitjäger des Forstbetriebs hatte mich noch vor dem ersten Tagesgrauen dort abgesetzt. Gerne hätte ich an jenem Morgen ausgeschlafen, aber alles kann man sich auch in fortgeschrittenem Alter nicht leisten. Erst zugeben, dass man vom ehrsamen „Knochensammler“ zum skrupellosen „Fleischjäger“ verkam und zu deppert war, das Alter eines Rehbocks definitiv korrekt zu benennen, und dann auch noch lieber pennen als jagen wollen? Nein, das hätte den Ruf vollends ruiniert!
Seit zwei Wochen war es in Kärnten daheim fast unerträglich heiß und auch jenseits der blauweißen Grenzpfähle war es nicht angenehmer. Aber noch war von der Hitze nichts zu spüren. Im Gegenteil, ich empfand es eher kalt als kühl. Der Vorabend war frei von Mineralwasser, die Nacht mehr als kurz ... Am Gras der Wiese hing der Tau, der die Hosenbeine durchnässte. Seit ich vor Jahren in stockfinsterer Maiennacht auf dem Heimweg umknickte und mir dabei einen doppelten Knöchelbruch zuzog, um hernach noch volle sechs Tage ohne ärztliche Hilfe herumzuhumpeln, weil die Hoffnung zuletzt starb, ist es schwierig, in enge Gummistiefel zu steigen.
Es war der Dreiklang der Wachtel, der mich aus meinem Halbschlaf an die Oberfläche holte, mir den Sinn meines Fröstelns wieder bewusst machte. Welch beglückendes Erwachen! In frühen Jugendjahren gab es im Mai und Juni kaum einen Frühansitz ohne Wachtelschlag, außer man saß fern von Wiese und Acker im Wald – pick-wer-pick!
Was ich gegen Trophäen hätte, fragte am Vorabend mein Gegenüber. Nichts – absolut gar nichts. Aber in den letzten vier Jahrzehnten schaffte es in unserem Haus ein einziger Bock – einer aus der Steiermark – an die Wand. Er bedeutet mir sehr viel, weil ich jenen noblen Gönner, der mich einlud, ganz besonders schätze. Und die Landschaft nahe der Riegersburg war so ganz anders als die Landschaften, in denen ich bis dahin zu tun hatte –
einfach liebenswert!
Die vielen „Leidensgenossen“ dieses Bockes, die mir in den letzten Jahrzehnten meiner Mordlust (mindestens fünf geharnischte Leserreaktionen …) zum Opfer fielen, ruhen in Kartons. Manche wurden verschenkt. Platz wäre nur noch im Schlafzimmer und auf der Toilette … Was also spricht dagegen, gerne auf „Wildbret“ auszuweichen? Es gibt so viele Jäger, junge und alte, die jagdlich weniger gesegnet waren und sich über einen Rehbock mehr freuen als über ein Kitz oder eine Geiß. Sollen sie –
meine Gefühle und Wertungen waren in jungen Jahren dieselben. Selbst die überfahrenen Jahrlinge mussten an die Wand!
Die Stille der frühen Stunde war vorbei. Hinterm Wald läuteten Kirchenglocken – sechs Uhr. Um halb acht wollte man mich abholen. Längst hatte der im ersten Morgenlicht so fleißige Wachtelhahn Feierabend gemacht. Pendler fuhren zur Arbeit. Erste Traktoren aufjaulend irgendwo im Gehügel. Die erste „corona-selten“ gewordene Boeing am Himmel, schon tief im Landeanflug. Schmaler Kondensstreifen, der, sich rasch auflösend, weiterhin gutes Wetter verkündete. Irgendwo sich wiederholend eine nervige Autohupe, die zum Aufbruch eines Langschläfers mahnen mochte.
Und dann – wie aus dem Nichts – kam eine Rotte Spätheimkehrer durch die taunasse Wiese, direkt auf meinen Sitz zu. Eine Bache war’s und hinter ihr fünf noch gestreifte Frischlinge! Sie mussten sich in der Nacht weit hinausgewagt haben und wurden zu fortgeschrittener Stunde vom Tageslicht überrascht. Vielleicht hatten sie sich auch in einem der schmalen Schilfstreifen eingeschoben und waren gestört worden. Längst hatte sich das Schwarzwild mit der immer intensiver werdenden Landeskultur arrangiert. Längst gab es Feldreviere, in denen es zum Standwild geworden war. Ein paar Hecken abseits der Wege, ein paar noch nicht jeder Begleitvegetation beraubte Gräben und von Mai bis November der die Landschaft verschlingende Mais …
Was ich getan hätte, wär‘s mein Revier gewesen, ob ich aufdiktierter Pflicht und durchaus Vernunft gefolgt wäre oder schlicht stillvergnügt geschaut und auf eine spätere Begegnung gehofft hätte? Ich musste mir die Frage nicht beantworten, war Gast. Ich wusste, wie man die Dinge hier sah, und war somit jeder eigenmächtigen Entscheidung enthoben. Keine 20 Meter neben mir verschwand die kleine Familie im Wald.
Wir schrieben den 21. Juni. Später berichtete der mich abholende Jäger, in den Abendnachrichten des deutschen Fernsehens hätte er Bilder von der Regenbogenparade in Wien gesehen. 150.000 Menschen sollen es gewesen sein. Der Kanzler hatte am Vortag entschieden, es gelte für diese Veranstaltung keine Maskenpflicht …
„Mit so was musst bei unserm auch rechnen“, war der trockene Kommentar meines Begleiters. Später, ehe ich mich an den Frühstückstisch setzte, kurzer Anruf bei meiner Frau. Alles in Ordnung? „Ja, stell dir vor, am Freitagabend ließen sich sechs Störche auf der große Föhre im Garten nieder!“ Unser Dorf liegt knapp 600 Meter hoch. Das ist für Störche schon grenzwertig. Und um es kurz zu machen, die Störche blieben bis zum Abflug ins Winterquartier in Nötsch, pendelten zwischen unseren Föhren und den Fichten vom Hans Peter. Ein Storch wurde Solist, begrüßte in der Früh mit Geklapper am Bahnhof all jene, die zur Arbeit fuhren.
Das Dorf war schon in Sicht, als mein Begleiter den Fuß vom Gas nahm und mich auf ein Reh aufmerksam machte. Kaum 100 Meter entfernt äste in einer Streuobstwiese ein Bock – ein Allerweltsrehbock. Ob ich vorsichtig aussteigen und auf dem Dach auflegen wolle? Nein, ich wollte nicht. Früher, ja früher mit alljährlich hohem Abschussauftrag hätte ich es getan. Aber jetzt, wo man zum Gast ab- oder aufgestiegen war, je nach momentaner Philosophie? Alles wäre zur Hektik geraten: das Versorgen des Bockes, das Frühstück, mein Zusammenpacken und mein Aufbruch in Richtung Kärnten.
Ich war zufrieden, hatte die taufrische Nachtluft geatmet, hatte gefröstelt und über jenen Zeitgenossen gelächelt, der sich am Vorabend so rührend Gedanken über meine Weidgerechtigkeit und meine vermeintliche Aversion gegen Trophäen gemacht hatte. Und da war ja noch jener Wachtelhahn, dessen Ruf heute fast so selten zu hören ist wie das Kullern der Spielhahnen. Nicht zu vergessen die Begegnung mit der Bache und ihren gestreiften Kindern. Ich war emotional satt!
Bruno Hespeler
Jagdkultur
Geweihleuchter der besonderen Art
Die sogenannten Lusterweibln – in Deutschland auch Lüsterweibchen genannt – zählen wohl zu den exklusivsten Formen eines Geweihleuchters. Woher aber kommen diese stilvollen Kronleuchter? ANBLICK-Reporter Herbert Trummler machte sich auf eine Spurensuche.
Im Revier
Zwischen Bären und Wölfen
Bereits ein bis zwei Fahrstunden südlich von Österreich gibt es Reviere, in denen sowohl Bären als auch Wölfe Dauergäste sind. Das Zusammenleben zwischen Mensch und Wildtier erfolgt keineswegs konfliktfrei, aber es hat Tradition.
Waffe, Schuss & Optik
„Wir verkaufen eigentlich zu billig!“
Der Hauptsitz von German Precision Optics – GPO befindet sich am Ammersee, ganz in der Nähe von München. Gründer und Eigentümer ist Richard Schmidt und seine Strategie ist klar: in jedem Segment 20 bis 30 Prozent preiswerter sein als der Mitbewerb, um schnell Marktanteile zu generieren.

Zurzeit ist einiges im Umbruch, auch im Bereich der Jagdoptik. Nicht nur dass klassische optische Systeme sukzessive durch digitale Lösungen ersetzt werden, auch bei den Anbietern tut sich einiges. Ein Newcomer in dem Segment ist German Precision Optics – kurz GPO. Das Unternehmen gibt es zwar erst seit 2015, doch es kann bereits auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.
Selbst ist der Mann
Gründer und Mehrheitseigentümer des Optikherstellers ist Richard Schmidt: „99 Prozent gehören mir, doch ein Prozent auch meiner Frau“, so der engagierte Bayer schmunzelnd im Gespräch. Zuvor war er in der Führungsebene bei Siemens und dann als Geschäftsführer bei der Carl Zeiss Sports Optics tätig, bevor er sich selbstständig machte. „Nach meiner beruflichen Karriere in Großkonzernen wollte ich einmal alleine verantwortlich sein“, meint er zu den Beweggründen für seinen Entschluss, GPO auf die Beine zu stellen. Und er wollte mit einer möglichst schlanken Struktur und ausgewählten Branchenexperten schnell und effizient zu Entscheidungen und Lösungen kommen, um wettbewerbsfähig zu sein.
Zu Beginn ging es einmal darum, am Markt Fuß zu fassen, was über den OEM-Bereich auch rasch gelang. Original Equipment Manufacturer wie GPO stellen Produkte oder Komponenten für Drittanbieter her, die jedoch nicht unter der Eigenmarke vertrieben werden. Parallel dazu wurden Ferngläser und Zielfernrohre aber auch schon unter der Marke GPO verkauft, mittlerweile ist dies das Hauptgeschäft. Und das läuft so erfolgreich, dass 2021 eine Umsatzsteigerung um beinahe 50 Prozent auf rund sieben Millionen Euro Gruppenumsatz erreicht werden konnte. Hätte es keine Lieferengpässe gegeben, wäre das Ergebnis noch besser ausgefallen.
Globales Netz
Am Stammsitz von GPO in Inning am Ammersee wird alles entwickelt, wobei Firmenchef Schmidt selbst tief in die technischen Belange verstrickt ist: „Wir arbeiten langfristig mit Partnern zusammen und helfen ihnen dabei, etablierte Produkte besser zu bauen – und das weltweit.“ So werden etwa die von GPO entwickelten Faserabsehen oder die mikroprozessorgesteuerten Beleuchtungssteuerungen für die Zielfernrohre in Deutschland gefertigt, die Spritzgussformen für die Magnesiumgehäuse kommen zu 100 % aus Japan, anderes stammt aus Shanghai oder anderen Teilen der Welt. „Man muss sich schon im Klaren darüber sein, dass man in Mitteleuropa keine Fernoptik für unter 500,- Euro fertigen kann“, erläutert Richard Schmidt. „Mit Herstellern aus Fernost zu kooperieren ist alternativlos, wenn man wettbewerbsfähig sein will. Die Kehrseite können allerdings Lieferengpässe sein, wie beispielsweise gerade jetzt, da Shanghai seit Wochen im Lockdown feststeckt und Fabriken geschlossen sind.“
Qualitätssicherung in Bayern
Ein Alleinstellungsmerkmal von GPO ist, dass alle Ferngläser, Zielfernrohre und Entfernungsmesser quasi in Großpackungen nach Inning am Ammersee geliefert werden. Erst hier erfolgt bei jedem einzelnen Gerät die Endkontrolle. „Je nach Charge rechnen wir mit einem Ausschuss von 2 bis 20 Prozent“, rechnet GPO-Gründer Schmidt vor. „Wenn es sich nur um kleine Mängel handelt, können wir diese teilweise vor Ort beheben, der Rest geht zurück ins Werk, um dort repariert zu werden. Deshalb bewegt sich die Rücklaufquote fehlerhafter Geräte vom Markt nur im Promillebereich. Und selbst da sind wir sehr kulant. Bei Mängeln tauschen wir das Gerät des Endkunden prompt gegen ein Neugerät um, wenn die Schäden nicht durch mutwillige Beschädigung entstanden sind.“
Auch die Verpackung und die Auslieferung erfolgen in der Zentrale in Süddeutschland, wobei auch hier die Ziele klar definiert sind. „Wir messen der Out-of-Box-Experience große Bedeutung bei“, so Schmidt, der sich auch hier mit den ganz Großen misst. Die Verpackung beispielsweise orientiert sich am Qualitätsniveau desselben Herstellers, der die bekannte IT-Marke mit dem Apfel im Logo beliefert: das Innenleben wasserstrahlgeschnitten und ebenfalls aus Deutschland. Aber auch der Designsprache kommt große Bedeutung zu: „Wenn ich einen Dreier-BMW kaufe, dann soll er auch zum Fünfer passen. Und ich will ihn nicht nur an dem weiß-blauen Logo erkennen, sondern auch am Außenspiegel“, formuliert Schmidt seinen bildhaften Vergleich. Aus diesem Grund finden sich dieselben Designelemente durchgängig im gesamten Produktportfolio von GPO.
Billiger, aber besser als die Konkurrenz
Das Herzstück von Schmidts Philosophie betrifft aber die Technik seiner Produkte. Die Gehäuse sind auch bei den preiswerten Einsteigerprodukten aus Magnesium, die Drehaugenmuscheln aus Aluminium, während der Mitbewerb hier oft Kunststoff einsetzt. Es geht ihm darum, möglichst leichte, kompakte Zielfernrohre und Ferngläser zu bauen, die es in puncto Leistung aber selbst mit der Premiumklasse anderer Hersteller aufnehmen können. So rangiert GPO in vielen Segmenten bezüglich Gewicht, Sehfeld oder Transmission im obersten Bereich aller Anbieter, obwohl die Produkte fast ausnahmslos die preisgünstigsten im jeweiligen Segment sind.
„Unser Portfolio umfasst den Bereich von 250,- bis 2.000,- Euro – von den Thermalgeräten einmal abgesehen“, erklärt Schmidt seinen Businessplan. Betrachtet man den Markt für fernoptische Produkte, werden von der Stückzahl her 60 % unterhalb der 500-Euro-Marke verkauft und nur ein Prozent im Bereich über 2.000,- Euro. „Diesen Super-Premium-Bereich überlassen wir anderen. Mein Ziel ist es, die hochwertige Optik zu einem besonders günstigen Preis anzubieten. Wahrscheinlich verkaufen wir unsere Produkte viel zu billig, im Schnitt sind sie um 20 bis 30 % preiswerter als die vom Mitbewerb. Aber ich bin selbst der Eigentümer. Ein anständiges Gehalt reicht mir zum Leben, der Rest fließt in die Firma zurück. Es geht mir also nicht darum, Gewinne, sondern Marktanteile zu generieren.“
„Der Vertrieb der hochwertigen optischen Geräte von GPO erfolgt über den Fachhandel in den zwei unterschiedlichen Distributionskanälen ‚Jagd‘ und ‚Natur/Outdoor‘“, erklärt Dr. Ralph Nebe, Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für Vertrieb und Marketing. Daneben gibt es zwar einen Webshop, in dem die Ferngläser zur jeweils höchsten unverbindlichen Preisempfehlung angeboten werden, aber keinen Vertrieb auf den großen Internetportalen, um das Preisdumping weitestgehend zu verhindern.
Stefan Maurer
Jagdkultur
Der Federnleser mit detektivischem Scharfsinn
Ein Haarbüschel auf dem Weg, eine Feder – von wem stammt sie? Was für viele von uns zum Waldquiz wird, ist für Claus Lassnig meist kein großes Geheimnis. Als Falkner und Ausbildner bei Falknerkursen hat er sich nämlich ganz spezielle Kenntnisse angeeignet – er ist ein echter Federnleser!
Unser Wild im Mai
Das geheime Leben der Dorffüchse
Städte und Dörfer bieten Füchsen alles, was sie brauchen. Oft sind es dabei besonders Tiere, die dem Neuen gegenüber aufgeschlossen sind, die solche Lebensräume erschließen. Ihre Neugier wird ihnen aber nicht selten zum Verhängnis.

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Rotfüchse den Weg in unsere Städte geschafft haben. Wie genetische Untersuchungen belegen, bilden sie dort weitgehend abgeschlossene Fortpflanzungsgemeinschaften. Der Austausch zwischen Land und Stadt ist mit anderen Worten nicht sonderlich groß. Die Stadt bietet den Füchsen alles, was sie benötigen: Schlafstätten, Verstecke, in denen sie ihre Welpen aufziehen können, und Nahrung im Überfluss. Was für die Stadt zutrifft, gilt im weitesten Sinne auch für das Dorf. Auch diese urbanen Strukturen verfügen über alles, was ein Fuchs benötigt. Und selbstverständlich nutzt der Fuchs des Offenlandes diese auch. Doch wie lebt „der Fuchs des Dorfes“ im Einzelnen? In einer meiner Fuchsstudien ging ich dieser Frage genauer nach.
Startschwierigkeiten
Eine erste Herausforderung bestand darin, Füchse an den Sender zu bekommen. Nach einigen Startschwierigkeiten und Fehlversuchen ergaben sich zaghafte Erfolge. Die ersten Füchse waren besendert und lieferten mir nun kontinuierlich ihre Aufenthaltsorte. Senderausfälle und der vorzeitige Tod von Füchsen warfen mich zwar leider regelmäßig wieder zurück, aber mein Vorhaben nahm Gestalt an. Nach und nach ergaben sich die Raumnutzungsprofile der Füchse, aus denen ich versuchte Muster zu identifizieren. Dabei erkannte ich unter anderem, dass es bezüglich Nutzung dörflicher Bereiche offenbar verschiedene Typen zu geben scheint. Da sind zunächst die Pendler zu nennen. Sie kommen mehr oder weniger regelmäßig, aber nicht täglich über das Jahr hinweg ins Dorf. Ihnen sind die ergiebigen Nahrungsquellen, wie z. B. Komposthaufen, in den Siedlungen wohlbekannt, die von ihnen auch gezielt und regelmäßig aufgesucht werden. Auch die Zeit, in der das Obst reif ist, lockt sie verstärkt in die Dörfer. Ich habe bei Mageninhaltsuntersuchungen in dieser Zeit immer wieder Füchse vorgefunden, deren Mägen prall mit Kirschen, Erdbeeren oder anderen süßen Köstlichkeiten gefüllt waren. Den Tag verschlafen sie jedoch stets außerhalb des Dorfes. In der Regel bleiben diese nächtlichen Gäste zumeist eher unbemerkt.
Kritische Phase
Bezüglich der Nutzung des Dorfes durch Füchse liegen in diesen Wochen andere Voraussetzungen vor. Denn der Nahrungsverbrauch der heranwachsenden Jungfüchse ist in dieser Zeit enorm. Dies veranlasst die Altfüchse, sich auch verstärkt im Dorf auf Suche zu begeben. Dies ist auch der Grund für die erhöhte Zahl an „Übergriffen“ auf Hühner und anderes Federvieh, die sich besonders auf die Zeit von April bis Juli konzentrieren. In dieser Zeit halten sich auch Füchse im Dorf auf, die sonst das ganze Jahr nicht in der Siedlung anzutreffen sind. Einen Senderfuchs erwischte ich sogar einmal in flagranti, als er sich mit einem Huhn im Fang aus dem Staub machen wollte. Mein Geschrei veranlasste ihn, seine Beute fallen zu lassen und das Weite zu suchen. Tatsächlich überlebte das Huhn diese Attacke sogar zunächst, sollte aber leider im Verlauf des Tages noch seinen Verletzungen erliegen.

Am gedeckten Tisch
Angesichts der allgemein günstigen Versorgungssituation macht es wenig verwunderlich, dass auch auf der Ebene von Dörfern Füchse existieren, die eine enorme Bindung an die Siedlung entwickeln. Zugleich verraten diese Exemplare viel über die erstaunliche Flexibilität und Plastizität dieser Spezies. Einer dieser Füchse war Freddy. Es war ein strammer Rüde, der zum Zeitpunkt seiner Besenderung zwei Jahre alt war. Den Gesichtsausdruck meines Direktors vergesse ich nie, wenn ich ihm regelmäßig von Freddy & Co. berichtete. Denn er konnte nur schwerlich verbergen, dass er der Namensgebung von Versuchstieren äußerst skeptisch gegenüberstand. Aber er ließ mich gewähren und hörte sich geduldig meine Reporte an. So durfte ich ihm auch berichten, dass die Ortungspunkte von Freddy zweifelsfrei dokumentierten, dass er das Dorf praktisch nicht mehr verließ. Entsprechend gering war auch sein Raumbedarf. Während die Füchse im angrenzenden Offenland eine Fläche von 250 ha beanspruchten, reichten ihm dazu etwa zehn Hektar. All seine Wurfgeschwister blieben, soweit ich es nachvollziehen konnte, Füchse des Offenlandes. Welche Lebenslaufstrategien Füchse im Einzelnen umsetzen, ist schwer zu erklären. Oft scheint das Gewicht eine Rolle zu spielen. Denn die damit verbundene Durchsetzungsfähigkeit verschafft ihnen Vorteile im Konkurrenzkampf um gute Reviere.
Außerdem scheint es so zu sein, dass jede Fuchspopulation in einem geringen einstelligen Prozentbereich „Sonderlinge“ zur Verfügung stellt. Während sich also der weitaus überwiegende Teil des Nachwuchses konservativ verhält und im Wesentlichen das tut, was ihre Eltern machen, gehen diese Tiere andere Wege. Ich nenne sie gern Eroberertypen. Freddy war ein solcher Eroberer. Eine Eigenschaft, die er und andere vergleichbare Füchse zeigen, ist, dass sie weniger Furcht gegenüber Neuem zu haben scheinen. Gerade deshalb endet ihr Schicksal oft tödlich, aber manchmal setzen sie sich auch durch und können einen neuen Lebensraum besiedeln und dort sogar neue Subpopulationen begründen. Stadtfüchse sind ein Beispiel dafür.
Den ausführlichen Beitrag finden Sie in unerer Mai-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Im Revier
Wirkt die Jagd als künstlicher Selektionsdruck?
Wer jagt, selektiert. In klassischen Räuber-Beute-Beziehungen kann die Selektion so stark werden, dass die Beutetiere sich daran genetisch anpassen. Trifft das auf die Jagd eventuell auch zu?
Im Revier
Junge Bären, fremde Väter und Menschen als Schutzschilde
Skandinavische Braunbärstudien zeigen, dass dort über ein Drittel der Jungen während der Paarungszeit stirbt. Und über 90 Prozent dieser Ausfälle gehen auf das Konto von Bärenmännchen, die nicht mit den Jungtieren verwandt sind. Bärenmütter wissen das und suchen Schutz im Nahbereich des Menschen.

Als ob es gestern gewesen wäre, erinnere ich mich noch daran. Es war ein sonniger Tag Ende Mai oder Anfang Juni, und ich wollte einen Rundgang im Langen Tal unternehmen. Das Lange Tal ist geprägt durch Dolinen und einen Wechsel zwischen Altholz und kleinen Lichtungen. Der gesamte langgezogene Streifen liegt mitten im Revier, ist aber wenig übersichtlich und nur sehr schwer zu bejagen, weil man hier immer wieder ganz unverhofft unmittelbar mit Wild zusammentrifft. Beim Abmarsch ließ ich meinem Hund freien Lauf; das heißt nicht, dass er buschiert oder weiter herumstreift, es bedeutet aber ebenso wenig, dass er bei Fuß geht. Der Hund bleibt bei mir, aber nachdem es jede Menge Fährten und Gerüche gibt, darf er in einem Umkreis von 10 bis 15 Metern seine Nase hineinstecken, wo er will. Nur muss er hinter mir bleiben. Wir waren nicht lange unterwegs, da war auch für eine wenig empfindliche menschliche Nase deutlich wahrzunehmen, dass hier ganz in der Nähe Rotwild sein musste. Damit war die Freiheit für Falk zu Ende, und er wurde an die Leine genommen. Wenig später stellte sich heraus – das war richtig, denn wir stießen auf ein Rudel Kahlwild. Die Chance für eine kurze Hetze hätte der frei folgende Hund wohl kaum ausgelassen, und gerade jetzt, wo die Tiere ihre jungen Kälber führen, sollten solche Störaktionen möglichst vermieden werden. Somit blieb der Hund an der Leine, was sich bald darauf als Glücksfall herausstellte.
Das Lange Tal ist unübersichtlich, Pirschsteige gibt es hier keine, unverhofft kommt man dem Wild oft sehr nahe. Keine zehn Minuten nach unserem Zusammentreffen mit dem Rotwild standen wir zwei erwachsenen Bären gegenüber. Zwischen uns waren etwa fünfzehn Meter – eher weniger – und die Bären machten keine Anstalt zu flüchten. Ich blieb, wo ich war, bis schließlich der eine Bär abdrehte und sich auf und davon machte. Der zweite blieb stur und versuchte immer wieder, mit hoch erhobenem Fang Wind zu holen. Ich weiß nicht, wie lange wir so von Angesicht zu Angesicht ausgeharrt haben – jedenfalls schienen mir die paar Minuten wie eine Ewigkeit. Schließlich drehte auch dieser Bär unwillig ab. Doch wirklich spannend wurde es unmittelbar danach. Nachdem beide Bären verschwunden waren, ließ die Anspannung nach. In dem Augenblick hörte ich plötzlich oben auf der großen Fichte, neben welcher der zweite Bär so lange ausgeharrt hatte, ein Kratzen und Raspeln, so als ob jemand die Rindenschuppen vom Baum kratzen würde. Erst jetzt sah ich den dritten Bären! Das Jungtier war die ganze Zeit oben auf dem Baum in Sicherheit gewesen und jetzt, wo sich die Mutter auf und davon gemacht hatte, kam auch der Kleine vom Baum herunter, zögerte, wagte dann mutig den Sprung auf den Erdboden und rannte so schnell er nur konnte seiner Mama hinterher. Nun begriff ich die gesamte Situation: Es war Bärzeit. Die beiden erwachsenen Tiere waren ein Bär und eine Bärin. Sie waren zur Paarung zusammen, und der kleine Einjährige hat sich vor dem erwachsenen Männchen auf dem Baum in Sicherheit gebracht. Erwachsene männliche Bären können dem Nachwuchs gefährlich werden. Dieser Bär ist gleich geflüchtet, die Bärin wollte ihren Nachwuchs nicht im Stich lassen …
Infantizid
Wer schon je über Infantizid im Tierreich gehört hat, der wird wissen, dass Löwenmännchen – wenn sie ein Rudel übernehmen – die Jungen töten. Die Löwinnen versuchen das zwar zu verhindern, aber sie haben in der Regel keine Chance. Es geht um die Paarungsbereitschaft der Weibchen. Solange sie Junge führen und säugen, sind sie nicht paarungsbereit. Um sich rasch fortpflanzen zu können, bringen deshalb die Männchen den noch nicht entwöhnten Nachwuchs eines anderen Vaters um. Beispiele gibt es dazu im Tierreich viele. Das reicht von Gorillas und Schimpansen über Ratten und Mäuse bis zu Störchen, Wasseramseln oder Staren und ist sogar bei Aquarienfischen bekannt. Der Braunbär gehört ebenfalls zu diesen Arten, wobei es im Fall von Infantizid streng genommen nur um die diesjährigen Jungen geht. Männliche europäische Braunbären können bis zu 400 kg Körpergewicht erreichen, fallweise schlagen große Männchen auch Jungtiere des letzten Jahres – es kommt beim Bären also auch zur „intraspezifischen oder inner-artlichen Prädation“. 2020 wurden zum Beispiel im Trentino zwei Jungbären von einem erwachsenen Männchen getötet und teilweise gefressen.
Indirekt kann auch die Jagd dazu beitragen, dass Infantizid gefördert wird. Werden dominante große Männchen über die Jagd entnommen, dann kann das bestehende stabile Sozialstrukturen stören. Fällt der dominante Bär aus, rücken andere Männchen nach und bringen Jungbären um. Untersuchungen in Schweden zeigen, dass der Ausfall eines erwachsen dominanten Männchens negative Auswirkungen auf das Überleben der Nachkommenschaft in einem Umkreis von bis zu 25 km haben kann. Die Jagd auf männliche erwachsene Bären kann also indirekt die Zuwachsraten beeinflussen.
Den ausführlichen Beitrag von Hubert Zeiler finden Sie in der Mai-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Im Revier
Wohin mit dem Hochsitz?
Um langfristig möglichst störungsarm und letztendlich erfolgreich jagen zu können, sind die Revierkenntnis und damit ein ausreichendes Wissen über Lage und Beschaffenheit von Einständen und Äsungsbereichen Grundvoraussetzung. Übernimmt man ein neues Revier, fehlt diese Kenntnis in der Regel. Andreas Haußer beschäftigt sich mit der Frage der richtigen Herangehensweise in so einem Fall.
Praxiswissen für Revierbetreuer
Jetzt wühlen sie wieder …
Schwarzwild verursacht nicht nur Wildschäden in Mais und Getreide. Besonders ärgerlich sind die in manchen Jahren und Regionen im Frühjahr besonders heftig auftretenden Wühlschäden in Wiesen und Weiden. Doch wonach suchen sie, wie ist das zu verhindern und worauf muss bei der Frühjahrsjagd besonders geachtet werden?

Wenn der Boden nach Frost und Schneelage im Frühjahr taut, dauert es meist nicht sehr lange, bis der Jäger die ersten dunklen Stellen im Grasland findet. Sie sind anfangs nur für den geübten, erfahrenen Blick erkennbar, werden aber rasch größer, flächiger und tiefer. Spätestens dann meldet sich ein verärgerter Landwirt, der die Wühlschäden beim Düngen seiner Wiese entdeckt hat. Wühlschäden im Grünland sind anders als die Fraßschäden in Mais, Getreide und anderen Feldfrüchten für den Landwirt durch die Folgen deutlich spürbarer. Zum einen wird sehr rasch die den Boden vor Erosion bedeckende Grasnarbe zerstört. Die Wiederherstellung einer intakten Narbe dauert einige Zeit. Viel schneller samen dort unliebsame, tief wurzelnde Unkräuter wie der großblätterige Ampfer an, der mit der Beschattung durch sein üppiges Blätterdach den jungen Graswuchs unterdrückt und lange Zeit den Bodenschluss verhindert. Das Relief der Bodenoberfläche wird durch die Aktivitäten der Sauen zudem so stark verändert, dass sich bereits nach kurzer Zeit tiefe, später ausgeschwemmte Löcher ergeben und das herausgewühlte Erdreich umliegend verteilt wird. Die in der hochtechnisierten Landwirtschaft gründliche Ernte, insbesondere von Frischgras und Silage, ist auf den Schadflächen so nicht mehr möglich. Wird der Schaden nicht zeitnah sorgfältig händisch oder maschinell behoben, verschlechtert sich der Zustand zusehends, bis eine Grasernte dort nicht mehr durchführbar ist. Ein Problem besonderer Art stellen die herausgewühlten Stücke der zerstörten Grasnarbe dar. Zum einen wachsen sie mit ein, zum anderen werden sie durch den Grasschnitt wieder gelöst und landen so im Viehfutter. Siliertes Futter schimmelt und verdirbt schnell. Nehmen die Rinder es dennoch auf, treten bei den hochsensiblen Tieren schnell Verdauungsprobleme, Zahnprobleme bis hin zu Vergiftungserscheinungen und Verkalben auf.

Wurzeln und Knollen
Sauen sind Allesfresser. Sie ernähren sich sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Kost, die sie oberirdisch genauso aufnehmen wie im Boden. Das typische Brechen ist Bestandteil ihres normalen Fressverhaltens, wobei auffällige „Erdarbeiten“ immer nur zeitweise im Revier zu beobachten sind. Nach einem langen Winter sind die Sauen im März und April nicht nur ausgehungert, sondern benötigen wie alle Tiere im erwachenden Frühling eine vermehrte Energiezufuhr, nicht zuletzt um den im Mutterleib nun rasch wachsenden Nachwuchs zu entwickeln.
Da der oberirdische Anteil verfügbarer Pflanzenkost im zeitigen Frühjahr unbrauchbar oder noch nicht ausreichend nachgewachsen ist, verlegt das Schwarzwild seine Suche auf unterirdische Pflanzenteile wie Wurzeln, Rhizome, Zwiebeln und Knollen. Die kurz vor dem Frühlingserwachen stehenden Speicher der Frühblüher sind nun besonders energiereich und bei den Sauen entsprechend beliebt. Im Flachland und auf den meisten „Turbo-Rasen“ sind sie allerdings durch eine ständige Überdüngung verschwunden und können nicht der wahre Grund für das Wühlen sein. Im sonnigen Laubwald hingegen werden die Sauen fündig und zeigen uns, wo sie auf der Suche nach Buschwindröschen und Co. sind. Anders sieht es auf den vom Stickstoffgehalt deutlich magereren Heuböden im Mittelgebirge oder in den Alpen aus. Besonders häufig finden wir hier noch Orchideen, Alpenveilchen, wilde Möhre und die beim Schwarzwild äußerst beliebten wilden Krokusse. Stoßen die wenigen Sauen, die sich in die höheren Lagen vorwagen, auf diese Vorkommen, werden auf der Suche nach den beliebten Zwiebeln gleich ganze Kolonien ausgegraben.
Den ausführlichen Beitrag finden Sie in unerer April-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Unter Jägern
Sauen ohne Ende – aber wie lange noch?
Mecklenburg-Vorpommern ist bekannt für sein Schwarzwild, doch die aktuell enormen Abschusszahlen sind auch hier ungewöhnlich. Statistisch umgerechnet, wurden zuletzt fünf Sauen pro 100 Hektar bejagbarer Fläche erlegt oder 8,3 pro Jagdscheininhaber. Das hat allerdings nichts mit steigenden Zuwächsen zu tun.
Waffe, Schuss & Optik
Indoor-Schießstand mitten in der Stadt
Schießstände befinden sich in vielen Fällen an abgelegenen Orten, damit sich durch den Schießbetrieb niemand gestört fühlt. Dass aber mitten in der Stadt Graz ein Schießstand realisiert wird, ist schon etwas Besonderes. Robert Siegert hat diesen Schritt gewagt und stellt sein neuestes Projekt stolz vor.

Die Grazer Puchstraße war schon vor Jahrzehnten jagdlich relevant. Schließlich hatte dort der Futtermittelhersteller Tagger seinen Sitz, dessen Erzeugnisse manchem Reh über gestrenge Winter geholfen haben. Just im ehemaligen Futtermittelsilo hat sich Robert Siegert mit seinem Schießstand eingemietet. „Für uns hat sich die Frage gestellt, ob wir ein Gebäude auf die grüne Wiese stellen oder nicht vielleicht bestehender Infrastruktur neues Leben einhauchen sollen. Dann haben wir einen Bauträger gefunden, der es möglich gemacht hat, unsere Vorstellungen so ressourcenschonend wie möglich umzusetzen. Der alte Futtermittelsilo ist der ideale Platz dafür.“ Dank Fotovoltaik an der Fassade und Wasserturbine im „Mühlgang“ kann sich auch die Nettoengergiebilanz im Vollbetrieb sehen lassen.
Die massive Betonkonstruktion des Gebäudes und die Ausgestaltung der ehemaligen Lagerräume haben sich ebenfalls als ideal erwiesen. Die enormen Raumhöhen geben dem Empfangsbereich mit Lounge und Shop den Charakter eines hippen Studios. Das großteils selbst entworfene Interieur gibt das Seinige dazu. Doch auch bezüglich Sicherheit hat der Altbestand einiges zu bieten. „Das S bei Caliber S steht ja in erster Linie für Sicherheit“, betont Robert, „nicht nur für Siegert. Wir schießen hier ja mit scharfer Munition, was sowohl in Bezug auf mögliche Umgebungsgefährdung als auch auf die Lärmemission hin nicht unproblematisch ist. Hier im ehemaligen Taggerwerk ist das kein Thema. Wo sonst kann man in einem Gebäude schon 70 Tonnen Sand für die Kugelfänge aufschütten oder so großzügig Schutzeinrichtungen installieren?“ Die Schießbereiche sind allesamt mit lärmabsorbierenden Materialien ausgekleidet, die zudem auch für passive Sicherheit sorgen. Die Kojen an den Ständen beispielsweise sind mit Stahlplatten verstärkt, damit die Gefährdung der Nachbarschützen ausgeschlossen wird. Zudem sorgt ein Belüftungssystem dafür, dass die Anlage einen Luftdurchsatz von 60.000 Kubikmetern pro Stunde hat, um Pulverschmauch und Verbrennungsrückstände zuverlässig abzusaugen. „Ein wichtiges Thema ist für uns die Wertstoffrückgewinnung“, betont Siegert weiter. „Sowohl die Geschoßrestkörper aus den Kugelfängen als auch die Messinghülsen können gut wiederverwertet werden und sind ein weiterer Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit.“ Zum Thema Sicherheit gehört aber auch, dass die Schießstände nur von Personen benutzt werden dürfen, die im Besitz eines waffenrechtlichen Dokumentes sind, also Waffenpass, Waffenbesitzkarte oder gültige Jagdkarte. Dazu braucht jeder Kunde eine Haftpflichtversicherung. Soweit diese nicht über die Jagdkarte vorliegt, kann um € 30,- ein eigenes Versicherungspaket abgeschlossen werden. Selbstverständlich ist die Anlage auch videoüberwacht, um völlige Transparenz zu gewährleisten. Für die „Dynamic Range“ brauchen Schießbegeisterte zudem ein „Level-2-Zertifikat“, um dort alleine oder in der Gruppe üben zu dürfen. Dieses ist nach entsprechender Instruktion vor Ort zu erwerben. Wer nur einmal Schießstandluft schnuppern will, kann sich gegen Voranmeldung unter Aufsicht geschulter Fachkräfte aber natürlich ebenso bewegen. Die Indoor-Anlage Caliber S verfügt über drei Kojenbereiche mit Entfernungen von bis zu 15 bzw. 25 Metern als auch 25 Yards, die für alle Waffen offen sind, wobei jeweils auch auf kürzere Entfernung geschossen werden kann. Es gibt also keine Kaliber- oder Munitionsbeschränkungen, selbst mit Flintenlaufgeschoßen sind Probeschüsse möglich.
Den ausführlichen Beitrag finden sie in unserer April-Printausgabe – kostenloses Probeheft anfordern.
Im Revier
Ein Blick auf Salzlecken
Salzlecken werden nicht ausschließlich vom Schalenwild aufgesucht. Wildkamerafotos, aber auch eigene Beobachtungen überraschen oft, wenn sich vom Hasen über Spechte bis hin zum Marder sämtliches Getier am Salz gütlich tut. Ihre Anlage ist denkbar einfach. Andreas Haußer stellt uns die gängigsten Varianten vor.

Die regelmäßige Annahme der Sulzen in Revieren, in denen Salzlecken vorhanden sind, zeigt, dass das Wild offensichtlich Bedarf hat, über die natürliche Äsung hinaus Salz aufzunehmen. In besonderem Maße frequentiert werden Salzlecken zu Zeiten des Haarwechsels, der Geweihbildung sowie in der Umstellung von der kärglichen Winteräsung auf frisches Grün. Doch auch in der restlichen Zeit des Jahres werden sie regelmäßig angenommen. Fest steht aber auch, dass Salzlecken oder Sulzen vor allem sämtliche heimische Schalenwildarten binden und anlocken können. Vor allem Muffelwild, aber auch Rotwild wandert weite Strecken, um salzige Erde aufzunehmen. Bestimmte Lebensraumabschnitte lassen sich durch ein zusätzliches Salzangebot ganz offensichtlich attraktiver gestalten – man bietet dem Wild eine besondere Art von Lebensraumkomfort. Doch Vorsicht: Zusätzliche Salzaufnahme steigert auch den Wasserbedarf. Dort, wo Salzlecken anstehen, dürfen Möglichkeiten zur Wasseraufnahme nicht fehlen. Anderenfalls deckt das Wild seinen (salzbedingten) Flüssigkeitsmangel auch durch Schälen oder den gesteigerten Verbiss von Knospen und frischen Trieben. Führt das zusätzliche Salzangebot mangels Möglichkeiten zur Wasseraufnahme zu einer spürbaren Steigerung von Verbiss oder Schäle, muss ihr Betrieb sofort eingestellt werden. In solchen Fällen sind auch die salzdurchtränkten Stämme zu räumen. Keinesfalls sollte der Lockeffekt von Salzlecken zur Abschusserfüllung genutzt werden.

Eine ideale Kombination bilden Schöpfstellen, Suhlen, Malbäume und Salzlecken, die versteckt im Einstand des Wildes liegen. Die Zahl der Sulzen im Revier richtet sich zum einen nach der Hauptwildart, zum anderen nach der Höhe des Wildbestandes. Die Salzlecken selbst können mit Speisesalz, Viehsalz, Steinsalz oder mit Minerallecksteinen bestückt werden. Aus Praxissicht ideal erscheinen die viereckigen gepressten Viehsalzlecksteine, die im Landhandel erhältlich sind. Das Loch in der Lecksteinmitte lässt sich leicht über einen eingeschlagenen Nagel stülpen, der ein seitliches Wegrutschen verhindert. Erfahrungsgemäß überdauert ein solcher Leckstein etwa ein Jahr, bis er vom Regen komplett aufgelöst worden ist. Nachteil: Die blauen oder weißen Steine sind gut sichtbar und werden immer wieder von „Sammlern“ mitgenommen. Sehr gut bewährt haben sich bisher auch immer die Naturlecksteine. Diese sind in großen, schweren Blöcken zu bekommen und müssen noch zerkleinert werden. Ihre Akzeptanz ist sehr hoch, sie haben eine lange Haltbarkeitsdauer und werden wegen ihrer Naturfarbe nicht so leicht gesehen. Sehr gerne vom Wild angenommen werden auch Mineral-Salzlecksteine. Ihr größter Nachteil: Feuchtigkeit zersetzt diese Lecksteine sehr schnell und aufgrund ihrer bunten Farben werden sie gut gesehen und leider auch gerne mitgenommen. Im Folgenden werden verschiedene Möglichkeiten zum Bau von Salzlecken beziehungsweise Sulzen, ergänzt durch praktische Tipps, dargestellt.
Den vollständigen Beitrag von Andreas Haußer finden Sie in der März-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Unter Jägern
Was tun, wenn der Hund streunt?
Es gibt mehrere Gründe, warum manche Hunde zu Streunern werden. Hat sich das Verhalten einmal etabliert, wird es schwer, es dem Hund wieder abzugewöhnen. Am besten helfen hier Vorbeugungsmaßnahmen wie eine enge Bindung an den Führer und Gehorsamsübungen vom Welpenalter an.
Jagdkultur
Wildbretkulinarik mit fünf Hauben
Wenn ein Restaurant fünf Hauben hat, darf man davon ausgehen, dass die Köche wissen, was gut ist. Und wenn man dann erfährt, dass in diesem Haus Wildbret rund ein Drittel des zubereiteten Fleisches ausmacht, hat man einmal mehr die Bestätigung, dass Wildkulinarik ein eminenter Bestandteil von genussvoller Küche auf höchstem Niveau ist. So erlebt im berühmten Restaurant Obauer im salzburgischen Werfen, wo ANBLICK-Reporter Herbert Trummler mit den beiden Spitzenköchen Karl und Rudi Obauer das folgende Gespräch führte.

Sehr geehrte Herren Obauer, wie könnten Sie Ihre höchst erfolgreiche Kochphilosophie, vor allem im Bereich Wildkulinarik, mit wenigen Worten beschreiben?
Rudi Obauer: Unser Motto lautet: Modernisierte Tradition. Wir brauchen – gerade in der Wildküche – das Rad nicht neu erfinden. Wir wollen die für unsere Region typischen Zubereitungsmöglichkeiten lediglich verfeinern.
Karl Obauer: Wir möchten die Authentizität und Natürlichkeit von Wildbret bewahren. Dieses Fleisch ist so ein großartiges und vielfältiges Lebensmittel, dass es wirklich eine Freude ist, damit tolle Gerichte zuzubereiten.
Was ist nun das Spezielle an der Obauer-Wildbretküche?
Rudi O.: Wir haben schon vor vierzig Jahren, als damals in den meisten Küchen das Wild zumeist noch viel zu lange gegart wurde, begonnen, die zarte und schonende Zubereitung zu forcieren.
Karl O.: Gerade Wildgeflügel wie Fasan oder ein Rebhendl muss man ja ganz zart behandeln, fast wie Fisch.
Obauer ist aber auch bekannt dafür, dass es mitunter kulinarische Wild-Raritäten gibt?
Rudi O.:Ja, wir sind zum Beispiel eine der wenigen, die auch Murmeltier zubereiten. Oder ganz was Besonderes ist unsere luftgetrocknete Auerhahnbrust, fein aufgeschnitten – eine kulinarische Sensation.
Karl O.: Aber noch einmal: Ganz wichtig ist die schonende Garung, weil übergart ist totgekocht.

Von wem beziehen Sie das Wildbret? Direkt von den Jägern?
Rudi O.: Ja, teilweise von den Jägern, aber der Großteil wird uns von „Tauernlamm“ geliefert. Das ist für uns ein verlässlicher Partner, zu dem wir bestes Vertrauen aufgebaut haben.
Karl O.: Und wir verwenden ausschließlich echtes Wild, also kein Gatterwild. Weil das ist für uns kein wirkliches Wild.
Schmeckt man da tatsächlich den Unterschied?
Rudi O.: Ganz sicher. Das kennt man schon an der Farbe, dann im Geruch und in der Struktur. Hundertprozentig. Und das schmeckt man dann natürlich auch.
Die Qualität muss also absolut top sein. Und wie ist es mit der Quantität? Wie viel macht Wildbret in der Obauer-Küche aus?
Rudi O.: Das ist natürlich saisonabhängig, aber übers Jahr gerechnet macht Wild sicherlich ein Drittel unseres Fleischaufkommens aus.
Das ist beachtlich viel. Gratulation! Und warum ist dann in der herkömmlichen, aber ebenfalls sehr guten Gastronomie, österreichweit gesehen, der Anteil an Wild so gering?
Karl O.: Viele Gasthäuser arbeiten ja schon weitgehend mit Convenience-Produkten und da gibt es halt auch ein viel geringeres Angebot an Wild. Das gilt übrigens auch fürs private Kochen.
Jetzt zur Verwendung des Fleisches: Die heutige Küche erlebt wieder ein Aufkommen der alten Tradition, dass man nicht nur die Gustostückerln zubereitet, sondern so ziemlich alles – Stichwort „From nose to tail“.
Rudi O.: Na ja, wir sagen da lieber „Vom Rüssel bis zum Schwanz“, und nicht das englische Zeug. Regionalität und Authentizität fangen ja schon bei der Sprache an.
Und wir Jäger sagen: „Vom Lecker bis zum Wedel – alles ist edel.“
Rudi O.: Ja, von mir aus. Aber es muss nicht immer alles englisch sein. Da verlieren wir ja unser Selbstbewusstsein, das sieht man eh bei weiten Teilen der Bevölkerung. Die verlieren ihre Identität und Authentizität komplett.
Das ausführliche Interview finden Sie in der März-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Wildtiere im Jahreskreis
Der Iltis
Der Iltis jagt gerne entlang von Gewässern, Hecken und Gräben. Im Frühjahr stehen dann vor allem Amphibien auf dem Speiseplan.
Jagderlebnis
Gamsjagd mit Höhen und Tiefen
Zwischen den Lärchenstämmen hindurch gewahrte ich einen schwarzen Fleck – Gams! Ich getraute mich kaum, mich zu rühren, stützte meinen Feldstecher auf den Bergstock und blickte hinauf zum Wild ...

Herrliche Jagderlebnisse hatte uns, meinem Jagdfreund Tom und mir, das neue Revier im Mariazellerland schon beschert. Die Jagdhütte war fertig eingerichtet und mit allem Notwendigen versehen worden, Reviereinrichtungen wurden repariert oder neu gefertigt und trotz all dieser zeitraubenden Arbeiten blieb genug Zeit für die Jagd. Der Rehwildabschuss war gut verlaufen und im Herbst waren noch einige weibliche Stücke frei. Die Möglichkeit auf die eine oder andere Geiß würde sich hoffentlich auch noch ergeben. Nur die Erfüllung des Gamsabschusses stellte uns vor Probleme. Na ja – Probleme. Eigentlich waren diese teils hausgemacht. Schon im August und September hätte sich die eine oder andere Möglichkeit auf eine Erlegung ergeben, doch stets blieb der Finger gerade. Mal war der Bock nicht alt genug, die Geiß zu stark und noch dazu ein Kitz führend, die Entfernung zu groß und ein andermal stand das Stück nicht richtig. Und schwarz sollten sie obendrein sein, die Gams, dann erst würde die Jagd jenes Erlebnis bieten, das wir uns von ihr erwarteten. Gerade Letzteres ist aber ein Trugschluss, zumal es eine Fehleinschätzung ist, mit dem Gamsabschuss zu lange zuzuwarten. Erstens ist auch die Jagd auf Sommergams erfüllendes Weidwerk, außerdem ist es nicht richtig, dem Wild den Hauptstress der Jagd in die ohnehin fordernde Winterzeit zu legen. Diese Lektion hatten wir nun gelernt, doch war der Novembermonat schon mehr als zur Hälfte vorbei – und auf der Habenseite des Gamsabschusses herrschte noch gähnende Leere. Wir erhofften uns nun von der einsetzenden Brunft eine Verbesserung der Jagdsituation.
Der Haupteinstand des Gamswildes in unserem Revier befindet sich in einem schroffen, schier unzugänglichen, steilen Bergmassiv, welches zudem noch dicht mit Lärchen und Fichten bestockt ist. Während der Hitzeperiode schützen diese Einstände die Gams vor der Sonne, erst wenn im Herbst kühlere Tage folgen oder die Gipfelregion von der weißen Pracht eingezuckert ist, zieht das Gamswild in tiefere Regionen und wird sichtbarer. Doch was den Schnee betrifft, war auch in der dritten Novemberwoche keine Kälteperiode oder Niederschlag zu erwarten. Dennoch mussten wir, Tom und ich, unser Bestmögliches versuchen.
Es war ein wunderschöner Spätherbsttag, als ich mich auf den Weg zum Felsensitz begab. Steil bergan geht der kaum sichtbare Steig durch einen schütter bestockten Fichtenhochwald. Rechts daneben zieht sich „die schmale Schneise“ hinauf, bis man zu einem mächtigen Felsmassiv gelangt, an dessen linker Vorderseite ein schmucker Bodensitz in das Gemäuer hineingebaut ist. Oberhalb des Sitzes verbreitert sich die Schneise stark und gewährt einen guten Ausblick auf einen breiten Kessel, der oben von weiteren Felsen begrenzt ist, die den Beginn des bevorzugten Sommereinstandes des Gamswildes markieren. Doch diesmal kam ich gar nicht hoch bis zum Sitz. Vorsichtig an der Kante des Felsmassivs hochpirschend, verharrte ich immer wieder, um mit dem Fernglas den Bereich über mir zu beleuchten. Und wirklich, zwischen den Lärchenstämmen hindurch gewahrte ich einen schwarzen Fleck – Gams! Ich getraute mich kaum, mich zu rühren, stützte meinen Feldstecher auf den Bergstock und blickte hinauf zum Wild. Sakra – das war ja eine ganz gut passende Geiß! Weit und breit kein anderes Stück. Und vor allem kein Kitz, das war das Wichtigste. Mit den Vorderläufen stand die Geiß auf einem Wurzelstock und es verging Minute um Minute, aber immerwährend verhoffte sie auf mich herab. Langsam wurde meine Position des stillen Verharrens unangenehm und Muskeln und Glieder begannen zu schmerzen. Nach einer gefühlten Ewigkeit trat die Geiß von ihrer erhöhten Position herunter und widmete sich wieder der Nahrungsaufnahme. Zum Eingang des Bodensitzes waren es noch gut fünfzehn Meter. Vor allem hätte ich aber jegliche Deckungsmöglichkeit aufgeben müssen, denn während des Einstiegs in den Sitz befindet man sich für wenige Augenblicke ganz frei – wie auf dem Präsentierteller. Also entschloss ich mich dazu, nicht ganz hochzusteigen, sondern mich hinter einen nur ein, zwei Meter höher gelegenen mit feuchtem Moos besetzten Felsbrocken zu kauern. Vorsichtig ließ ich den Rucksack von den Schultern gleiten, zog die Kipplaufbüchse aus der Waffenhalterung heraus und richtete mich ein. Die Geiß schien misstrauisch geworden zu sein und zog bereits höher, dem Einstand zu ...
Das vollständige Jagderelbnis von Hermann Reichl finden Sie in der Februar-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Im Revier
Kleearten als Wildmagneten
Rehe als Konzentratselektierer äsen mit Vorliebe Knospen, Kräuter und Klee. Doch auch die anderen Schalenwildarten und selbst die Sauen verachten Klee als Äsung nicht.
Dabei ist Klee nicht gleich Klee. Es gibt eine Reihe von Kleearten. Welche davon dem legendären Ruf eines echten Wildmagneten entsprechen, soll in einem Feldversuch unter gleichen Bedingungen in einem Waldrevier mit einem guten Reh-, Muffel- und Schwarzwildbestand geklärt werden.
Unser Wild im Februar
Nur eine Laune der Natur?
Brunfthirsche im Winter, ein zitternder Junghase auf blanker Scholle. Was wie ein Fehler der Natur aussieht, macht manchmal durchaus Sinn, bedeutet aber für das Individuum selbst ein lebensbedrohliches Risiko.

Das zentrale Ziel eines jeden Tieres ist, so viel eigenes genetisches Material wie möglich an die nächste Generation weiterzugeben. Das bedeutet im Wesentlichen, Junge zu produzieren, die vital genug sein müssen, um sich selbst erfolgreich fortzupflanzen. In diesem Zusammenhang werden permanent Strategien entwickelt. Die Logik der Natur ist dabei nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen, und gelegentlich kommt es auch zu „Unfällen“. Einen scheinbaren Unfall fand ich vor einiger Zeit bei einer Untersuchung an Feldhasen. Dabei fiel mir auf, dass einige Häsinnen bereits im ausgehenden Winter setzten. Bis zu vier Jungtiere können dann schon im Februar gesetzt werden. Normalerweise werden zu Beginn der Reproduktionszeit jedoch kleine Sätze produziert. Erst wenn sich die Bedingungen zum Sommer hin deutlich verbessert haben, wird die Jungenzahl pro Satz erhöht. Bereits im Winter viele Junghasen zur Welt zu bringen erscheint demnach zuerst einmal widersinnig. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es noch einmal richtig kalt und nass wird, ist hoch. Die Situation erschwert sich für die jungen Hasen zudem dadurch, dass das Geburtsgewicht bei größeren Sätzen reduziert ist. Entsprechend gering ist ihre Überlebenswahrscheinlichkeit. Für die Häsin bedeutet dies eine hohe Investition mit ungewissem Ausgang. Bleibt diese Phase jedoch mild, hat sich das Risiko ausgezahlt. Inwieweit diese Strategie vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung künftig öfter zu beobachten ist, bleibt abzuwarten. Das Verschieben des Setzzeitpunktes gehört zu den Anpassungen, die in der jüngeren Vergangenheit öfter nachgewiesen werden konnten. Forscher machten auf der schottischen Insel Rum diesbezüglich interessante Beobachtungen. Dort wird Rotwild dauerhaft seit Anfang der 1970er-Jahre wissenschaftlich erforscht. Die Auswertung der Langzeitergebnisse unter der Leitung von Prof. Tim Clutton-Brock wies nach, dass es über die Jahre zu einer allmählichen Verschiebung des Brunftbeginns gekommen war. Danach hatte sich die Brunft in den vergangenen Jahrzehnten um etwa zwei Wochen nach vorne verschoben. Der Grund für diese Verschiebung wird im zeitiger eintretenden Frühjahr gesehen.

Winterliche Brunft bei unserem Rotwild
Auch bei uns lässt sich teilweise zeitlich mehr oder weniger stark abweichendes Brunftgeschehen feststellen. Dabei werden zum Beispiel Nachbrunften beim Rotwild bis in den Dezember hinein festgestellt. Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel sind diese jedoch nicht Ergebnis einer systematischen Veränderung. Vereinzelte spätbrunftige Stücke lösen aus, dass auch die Hirsche noch einmal brunftig werden. Nimmt ein Alttier während des ersten Eisprungs nicht erfolgreich auf, erfolgt im Mittel 18 Tage später ein erneuter Östrus. Dies kann sich bis zu sechsmal wiederholen. Besonders häufig kommt es bei körperlich schwachen und überalterten Alttieren vor. Im Ergebnis kann dies zu der paradoxen Situation röhrender Hirsche im Winter führen. Die Kälber aus diesen Beschlägen werden dann jedoch erst im August oder September gesetzt – weit nach der sonst üblichen Setzzeit im Mai/Juni. Entsprechend groß ist das Entwicklungsdefizit dieser Stücke. Im Allgemeinen überleben sie den nachfolgenden Winter nicht. Ein vergleichbares Phänomen lässt sich beim Rehwild feststellen. Auch bei dieser Wildtierart kann es zu sehr späten Beschlägen kommen. Dies ist jedoch nicht die Regel. Entsprechend liegt die Zahl der in der Winterbrunft gezeugten Kitze im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Eine Keimruhe findet bei diesen Beschlägen nicht statt, denn die Embryos wachsen dann ohne Verzögerung bis zum Setzzeitpunkt. Besonders interessant ist, dass dabei auch Kitze beschlagen werden können, die zu diesem Zeitpunkt selbst erst etwa ein halbes Jahr alt sind. Dieses Verhalten wird in der Biologie als Säuglingsträchtigkeit bezeichnet, ist bei unserem Rehwild allerdings äußerst selten. Anders verhält es sich diesbezüglich zum Beispiel bei Feldmäusen. Sie setzen diese Strategie konsequent im Sinne der Steigerung ihrer Reproduktionsleistung ein. Feldmäuse können bereits ab dem 13. Lebenstag aufnehmen. Die Kopulation erfolgt demnach zu einem Zeitpunkt, wo sie selbst noch gesäugt werden.
Den ausführlichen Beitrag von Dr. Konstantin Börner finden Sie in der Februar-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Waffe, Schuss & Optik
Wärme bringt Licht ins Dunkel
Wie von Geisterhand wird scheinbar Unsichtbares plötzlich wahrnehmbar: sei es das Reh, das vormittags gut getarnt im herbstlich braunen Brombeergestrüpp äst, oder der Fuchs, der in finsterer Nacht entlang der Ackerfurche schnürt. Dank der vom Körper abgegebenen, aber für das menschliche Auge nicht sichtbaren Infrarotstrahlung lassen sich mit Wärmebildgeräten Lebewesen rasch und zuverlässig lokalisieren.
Verhaltensforschung in der Wildbiologie
Liebe geht durch den Pansen
In ihrer Verhaltensforschung beschäftigen sich Wildbiologen häufig mit dem Sozialverhalten, beispielsweise bei der Paarung oder der Jungenaufzucht. Doch auch das Äsungsverhalten gibt viele Rätsel auf, denn Gämsen beispielsweise nutzen Äsungsflächen ganz bewusst, während sie andere aus gutem Grunde meiden.

Weit oberhalb der Waldgrenze auf über 2.000 Meter Seehöhe ruht schon seit den frühen Morgenstunden ein Gamsbock. Es ist ein kalter, jedoch sonniger Wintertag und die zaghaft wärmenden Sonnenstrahlen tun dem Wildtier nach Tagen mit Schnee und Sturm ebenso gut wie mir. Erst um etwa zehn Uhr vormittags wird der Gams hoch und beginnt auf dem abgewehten Rücken zu äsen. Dabei bewegt er sich kaum vom Fleck und sichert auch nicht. Nach einer guten halben Stunde liegt der Bock wieder dort, wo er wahrscheinlich die lange, kalte Winternacht verbracht hat. Wer über das Verhalten von Wildtieren nachdenkt, dem kommen zunächst wohl Bilder von Balz und Brunft in den Sinn, die Brutpflege, das Spiel der Jungtiere, Angriff und Verteidigung. Optimale Ernährungsstrategien sind da eher nicht dabei – dennoch, Energieaufnahme und Energieverbrauch sagen mehr über Verhalten und Gemeinschaftsleben von Wildtieren, als auf den ersten Blick zu erkennen ist. Eigentlich stehen sie ganz am Anfang.
Grün ist die Welt
Der Gams oben am Berg hat nicht mehr viel Auswahl, wenn er im Winter Äsung aufnimmt – Ruhe und Energiesparen sind deshalb wichtige Verhaltensweisen, um die Energiereserven, die er während des Sommerhalbjahres angelegt hat, nicht allzu schnell aufzubrauchen. Je nach Jahreszeit können Pflanzenfresser jedoch aus einem weiten Nahrungsspektrum auswählen. Das reicht von nahrhaften Nüssen und Sämereien über Beeren und Obst bis zu Trieben, Knospen, Blättern, Kräutern, Gräsern und Rinde. Je nach Lebensraum schwankt dieses Angebot, und je nach Lebensraum passen sich auch Wildtiere daran an. Vereinfacht leben im Wald eher kleinere Arten, die hochwertige Äsung selektieren. Im offenen Grasland sind größere Pflanzenfresser daheim – sie brauchen mehr, aber dafür weniger gute Nahrung. Diese Raufutterfresser sind größer als die Selektierer. Die kleineren Arten im Wald leben meist einzeln oder paarweise, die großen Tiere in der offenen oder halb offenen Landschaft wandern in Gruppen, Rudeln oder Herden gemeinsam durch weite Streifgebiete. Das sind Grundmuster. Sowohl die Ernährungsweise als auch der Lebensraum korrelieren also gut mit der Körpergröße. Nur um die Bandbreite deutlich zu machen: Das Körpergewicht von Huftieren schwankt je nach Art zwischen 1,5 und 1.600 Kilogramm. Ernährung und Lebensraum führen uns dann zur Größe der Gruppe, und die Größe der Rudel führt wieder zu bestimmten Verhaltensformen. Die kleinen Busch- oder Waldbewohner verhalten sich häufig territorial – sie verteidigen Reviere. In den offenen Grassteppen gibt es Äsung genug, da braucht man nichts verteidigen. In den großen Herden gibt es aber auch viele Weibchen. Jedes Männchen, das um sie wirbt, muss sich gegen Konkurrenten durchsetzen. Für gewöhnlich sind die großen, stärkeren Männchen erfolgreich. Nachdem sie sich öfter paaren, geben sie auch ihr Erbgut häufiger weiter. Bei vielen Arten entwickelten die Männchen auch Geweihe oder deutlich stärkere Hörner als die Weibchen. In der Regel dienen diese nur, um die Kräfte im Wettstreit um die Fortpflanzung zu messen. Vereinfacht führte das über Jahrmillionen zu einem auffälligen Geschlechtsdimorphismus, verbunden mit Polygamie. Das heißt, die großen, dominanten Männchen setzen sich gegen Konkurrenten eher durch und verteidigen einen Harem – ein Brunftrudel. Wir sind nun über Ernährung, Lebensraum und Gruppengröße mitten beim Thema Verhalten angekommen.
Den ausführlichen Beitrag von Dr. Hubert Zeiler finden Sie in der Jänner-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.
Im Revier
Raubwildbälge spannen und trocknen
Reife Winterbälge sind wertvolle Naturprodukte. Es lohnt sich in jedem Fall, sie zu Pelzwerk verarbeiten zu lassen. Neben einer den Balg schonenden Jagd muss der Jäger dafür das Streifen der Jagdbeute beherrschen. Das Trocknen des Rauchwerks im Anschluss stellt immer noch die beste und in vielen Fällen auch die einzige Lösung dar.
Im Revier
Gamswild ansprechen
Anders als bei den Hirschartigen tragen beim Gamswild beide Geschlechter praktisch gleich aussehende Hörner, was es schwierig macht, Bock und Geiß auf den ersten Blick zu unterscheiden. Daher kommt es auf mehrere Merkmale und einige Übung an, um sie besser unterscheiden zu lernen. Gerade das richtige Ansprechen ist aber wichtig, um einen guten Erhaltungszustand dieser Wildart zu garantieren.

Beim Nässen sind die Geschlechter zu allen Jahreszeiten und in allen Altersklassen recht zuverlässig erkennbar. Geißen haben einen nach hinten gerichteten Harnstrahl (links). Böcke nehmen beim Nässen zwar oft eine ähnliche Haltung ein, der Harn wird aber über die Brunftrute nach vorne abgesetzt.
Wie bei allen anderen Schalenwildarten erfordert auch das Ansprechen von Gamswild Übung, Erfahrung und (selbst)kritisches Denken. Ist es oft schon nicht auf den ersten Blick möglich, zwischen einem Gamsbock und einer Gamsgeiß zu unterscheiden, gestaltet sich das Ansprechen zwischen Mittel- und Altersklasse, vor allem im Grenzbereich, noch viel schwieriger. Die Bestimmung des Alters am erlegten Gams bereitet aufgrund der Jahresringe an den Krucken nur selten Probleme. Gamsjägerinnen und Gamsjäger sollten allerdings am lebenden Stück zumindest entscheiden können, welches Geschlecht und ungefähre Alter eine Gämse hat.
Geschlecht, Alter, Gesundheit
Angesprochen werden Gämsen hauptsächlich nach Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand. Mitunter gestaltet sich bereits die Unterscheidung zwischen Bock und Geiß schwierig. Erschwerend wirkt sich beim Ansprechen von Gamswild auch das im Jahreslauf sich stark ändernde Erscheinungsbild aus. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Anhaltspunkte, auch Verhaltensweisen oder spezielle Körperhaltungen, wie beispielsweise beim Nässen, stellen Entscheidungshilfen dar. Für das Ansprechen sind ausreichend Zeit und eine gute Optik (Spektiv) erforderlich.
Gamsbock oder Gamsgeiß?
Das wichtigste Ansprechkriterium beim Gams ist zuallererst das Geschlecht. Um es zweifelsfrei erkennen zu können, kann man sich mehrerer Indizien bedienen. Die im Normalfall im Umfang massigere und stärker gehakelte Krucke spricht in der Regel für einen Bock. Dieses Merkmal lässt sich ab dem zweijährigen Stück – meist jedoch schon beim Jahrling – feststellen. Auslage und Höhe der Krucke sagen nichts über das Geschlecht aus, falls die Form des Querschnitts erkennbar ist, kann eine ovale Form auf eine Geiß hindeuten, während die Schläuche des Bockes im Querschnitt annähernd rund sind. Bilden sich Bockrudel, verhalten sich diese größtenteils standorttreuer als Geißenverbände, die wegen des hohen Energiebedarfs aufgrund der Laktation und der meist größeren Rudel im freien Gelände häufig weiter umherziehen.
Das Gesäuge der Geiß oder das Kurzwildbret des Bockes sind meist nur im Sommer bei günstiger Position des Beobachters sichtbar. Das längere Winterhaar verdeckt diese Region, zudem ist dann das Gesäuge führender Geißen auch schon kleiner. Einen relativ sicheren Anhaltspunkt zum Ansprechen des Geschlechtes bietet die Haltung des Stücks beim Nässen. Geißen knicken die Hinterläufe dabei ein, während der Bock seine Körperhaltung beim Nässen meist nicht ändert oder den Rücken nur leicht senkt – ein Verhalten, das auch schon bei den Kitzen beobachtet werden kann. Absolute Sicherheit bei jüngeren Tieren, aber auch manchem älteren Bock bietet die Körperhaltung beim Nässen allerdings erst, wenn auch der Harnstrahl beobachtet werden kann – bei Kitzen ist dies der einzige sichere Weiser für das Geschlecht.

DER neue Lernbehelf für Gamsjäger!
Aus umfangreichem und hochwertigem Bildmaterial wurden die besten Beispiele herausgesucht, um dem interessierten Gamsjäger weitere Hilfestellung zu bieten, wie er sein Ansprechen in der freien Natur verbessern kann. Denn wir sind österreichweit in der Gesamtverantwortung, das Durchschnittsalter der Gamswildbestände durch bemühtes Ansprechen und umsichtige Jagd zu heben. Damit wäre dem Gamswild in der derzeitigen Situation sehr geholfen. Ausreichend alte Gams sind von enormer Bedeutung für den Bestand. Dieser Ratgeber für die Praxis soll zur fachgerechten, zielorientierten und disziplinierten Bejagung des Gamswildes beitragen und damit die Akzeptanz für diese faszinierende Wildart erhalten helfen.
Armin Deutz, Rupert Prem, Gunther Greßmann, Friedrich Völk, Flurin Filli: „Gamswild ansprechen. Geschlecht – Alter – Gesundheit“ (1. Auflage 12/2021). 50 Seiten, Format A 4, durchgehend in Farbe. Erhältlich direkt bei Armin Deutz (armin.deutz@aon.at) und den österreichischen Landesjagdverbänden.
Waffe, Schuss & Optik
Präzision aus Erding
Die Unique Alpine AG aus dem bayerischen Erding steht mit ihrem Namen seit Jahren hauptsächlich für Präzisionswaffen in den Bereichen Militär, Behörden und Sport. Doch auch für die Jagd haben die findigen Waffenbauer einige Modelle in ihrer Palette. Unter anderem die JPR-1 Nordland Scout, die uns übers Jahr im Revier und auf dem Schießplatz begleitete.